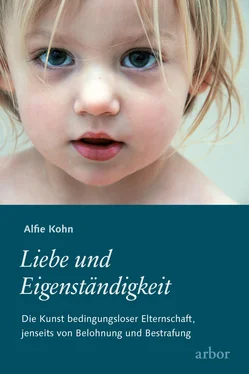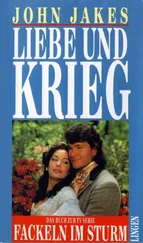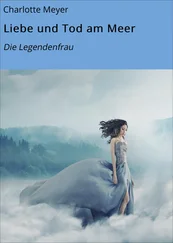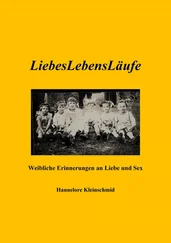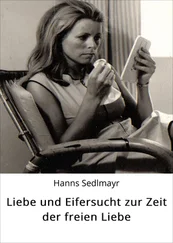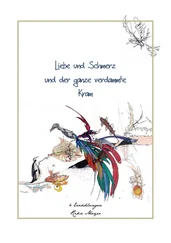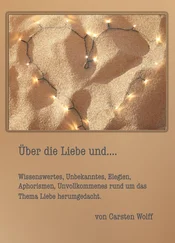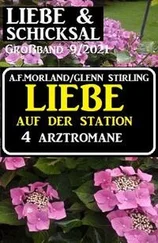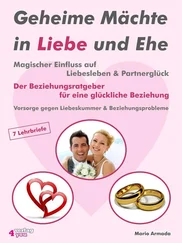Loben führt dazu, dass Kinder weniger in der Lage oder bereit sind, Stolz auf ihre eigenen Leistungen zu empfinden – oder zu entscheiden, was überhaupt eine Leistung ist. In extremen Fällen können sie „süchtig“ nach Lob werden und auch als Erwachsene noch von der Bestätigung anderer abhängig sein, überglücklich oder niedergeschlagen sein, je nachdem, ob ihr Partner, ihr Chef oder jemand anders, den sie als Autorität ansehen, ihnen sagt, sie hätten etwas gut gemacht oder nicht.
Alle kleinen Kinder haben ein tiefes Bedürfnis nach der Anerkennung ihrer Eltern. Das ist der Grund, weshalb Lob kurzfristig oft „funktioniert“, um sie dazu zu bewegen, das zu tun, was wir wollen. Doch wir haben die Verantwortung, ihre Abhängigkeit nicht um unserer eigenen Bequemlichkeit willen auszunutzen – und genau das tun wir, wenn wir sie demonstrativ anlächeln und etwas sagen wie: „Ich finde es wirklich toll, wie schnell du dich heute Morgen für die Schule fertig gemacht hast!“ Es kann sein, dass sich Kinder durch diese „mit Zuckerguss überzogene Kontrolle“ 14manipuliert fühlen, auch wenn sie nicht recht erklären können warum. Doch unabhängig davon, ob sie es durchschauen und sich dagegen auflehnen oder nicht, hat diese Methode etwas entschieden Unangenehmes. Im Grunde ist sie nicht viel anders, als ob Sie warten würden, bis Ihr Kind Durst bekommt, und ihm nur Wasser gäben, wenn es etwas täte, was Ihr Leben ein bisschen leichter macht.
Zudem lässt positive Verstärkung oft einen Teufelskreis entstehen, der an den erinnert, der beim Liebesentzug zu beobachten ist: Je mehr wir loben, umso mehr wächst das Bedürfnis unserer Kinder nach Lob. Sie wirken unsicher, sehnen sich danach, dass wir ihnen noch einmal den Kopf tätscheln; wir tun es und ihr Verlangen steigert sich noch. Carol Dweck, Psychologin an der Columbia University, hat Voruntersuchungen angestellt, die vielleicht erklären können, was hier geschieht. Wenn wir Bemerkungen äußern, die „eine bedingte Anerkennung andeuten (und dadurch vermutlich das Gefühl eines nur bedingten Wertes aufkommen lassen)“, beginnen kleine Kinder, Zeichen von Hilflosigkeit zu zeigen. Positive Verstärkung ist eine Form bedingter Liebe, und Dweck argumentiert, es sei nicht nur eine bestimmte Eigenschaft oder ein Verhalten, das wir nur unter gewissen Bedingungen akzeptierten. Vielmehr sehe das Kind sein „ganzes Selbst“ nur dann als gut an, wenn es den Eltern gefällt. Dies ist eine wirksame Art, das Selbstwertgefühl zu untergraben. Je öfter wir „gut gemacht!“ sagen, umso schlechter wird das Selbstwertgefühl des Kindes und umso mehr Lob braucht es. 15
Natürlich sollte uns das skeptisch hinsichtlich der Behauptung machen, Lob sei in Ordnung, weil Kinder offenbar danach verlangten. Wenn Sie Geld verdienen müssen und der einzige verfügbare Job aus sich ständig wiederholender, stumpfsinniger Plackerei besteht, nehmen Sie ihn vielleicht als letzten Ausweg an. Doch das bedeutet nicht, dass Sie eine solche Arbeit gutheißen. Es heißt nur, dass man das nimmt, was man bekommen kann. Was Kinder wirklich brauchen, ist Liebe ohne Bedingungen. Doch wenn alles, was ihnen angeboten wird – als einzige Alternative zu Kritik oder Missachtung – Anerkennung ist, die auf dem beruht, was sie getan haben, saugen sie die auf und verlangen vielleicht mit einem vagen Gefühl der Unzufriedenheit nach mehr. Manche Eltern, die in ihrer Kindheit zu wenig bedingungslose Liebe bekommen haben, diagnostizieren dieses Problem traurigerweise falsch und glauben, es habe ihnen an Lob gefehlt. Dann überschütten sie ihre Kinder mit „gut gemacht!“ und sorgen so dafür, dass wieder eine Generation nicht das bekommt, was sie wirklich braucht.
Viele Eltern haben mir gesagt, es sei hart, diese Erklärungen zu hören, besonders beim ersten Mal. Es ist schon schlimm genug, wenn jemand andeutet, dass Sie bei Ihren Kindern vielleicht etwas falsch machen, doch es ist noch schlimmer, gesagt zu bekommen, dass genau das, was man richtig zu machen glaubte und worauf man bisher stolz war – etwa darauf, die eigenen Kinder zu loben, damit sie ein gutes Selbstwertgefühl entwickeln –, in Wirklichkeit vielleicht mehr Schaden als Nutzen anrichtet.
Manche Leute erwidern darauf: „Was ist die Alternative?“ Das ist eine sehr vernünftige Frage, sofern wir uns mit Alternativen zum ganzen Konzept einer an Bedingungen geknüpften Erziehung befassen (wie ich es später tun werde), statt nur oberflächliche Änderungen dessen, was wir zu Kindern sagen – eine neue, verbesserte Version des Lobens –, anzustreben.
Manche Leute fühlen sich bei diesen Gedanken unbehaglich und machen nervöse Witzchen: „Haha. Dann kann ich Ihnen wohl nicht sagen, dass mir Ihr Buch gefallen hat, weil ich Sie dadurch ja loben würde. Hahaha.“ 16Das ist verständlich. Es dauert eine Weile, bis man eine neue Vorstellung akzeptieren kann, vor allem eine, die uns veranlasst, vieles von dem, was wir bisher getan haben und wovon wir ausgegangen sind, zu überdenken. Wir müssen uns an das neue Konzept gewöhnen, es ausprobieren und während der Übergangsphase kann sich unser Unbehagen auf vielerlei Weise Ausdruck verschaffen.
Manche Leute fragen sich, ob das bedeutet, dass sie schlechte Eltern seien, weil sie sich lange auf Liebesentzug und positive Verstärkung verlassen haben (selbst wenn sie diese Bezeichnungen nie verwendet haben). In den meisten Fällen ist es jedoch einfach so, dass niemand ihnen bisher die Möglichkeit aufgezeigt hat, die Dinge so zu sehen, oder ihnen Beweise präsentiert hat, die Zweifel aufkommen lassen an all den ständigen unkritischen Ratschlägen, unsere Kinder öfter zu loben oder Auszeiten zu verhängen.
Manche Leute allerdings fragen weder nach Alternativen, noch versuchen sie, lustig zu sein, noch machen sie sich Sorgen. Stattdessen tun sie diese Kritik ab und weisen (mit einer gewissen Berechtigung) darauf hin, dass wir mit unseren Kindern viel Schlimmeres tun könnten, als Enthusiasmus über das, was sie getan haben, zum Ausdruck zu bringen. In der Tat wird Kindern jeden Tag viel Schlimmeres angetan. Jedoch ist das keine gute Grundlage für einen Vergleich – jedenfalls nicht für Menschen, die die besten Eltern sein wollen, die sie sein können. Wichtig ist, dass wir etwas Besseres tun können.
Die Kontroverse zum Thema Selbstwertgefühl
Liebesentzug und positive Verstärkung können eine Reihe beunruhigender Folgen haben, von einem Gefühl der Hilflosigkeit bis hin zu einer mangelnden Bereitschaft, anderen zu helfen, und (wenn die Kinder erwachsen sind) von der Angst, verlassen zu werden, bis hin zu einem Groll gegenüber ihren Eltern. Doch die Auswirkung, die sich durch die in diesem und dem vorigen Kapitel zusammengefassten Forschungsergebnisse hindurchzieht, hat damit zu tun, wie sich Menschen, die einer an Bedingungen geknüpften Erziehung ausgesetzt waren, selbst einschätzen.
Die übliche Bezeichnung dafür ist Selbstwertgefühl, was im Lauf der letzten Jahrzehnte zu einer Art Schlagwort geworden ist. Bevor ich dieses Kapitel abschließe, möchte ich ein paar Seiten dafür aufwenden, dieses Konzept zu analysieren, weil es für den an Bedingungen geknüpften Erziehungsansatz wichtig ist. Etliche Leute aus den Bereichen Psychologie und Pädagogik, ganz besonders jene, die mit dem, was als Selbsthilfebewegung bezeichnet wird, zu tun haben, scheinen zu glauben, ein starkes Selbstwertgefühl sei gut, ein geringes sei schlecht, und wenn man den Grad des Selbstwertgefühls bei jemandem steigere, führe das automatisch zu einer Reihe positiver Auswirkungen: akademischen Leistungen, konstruktiven Lebensentscheidungen und so weiter. Auf der anderen Seite ist Selbstwertgefühl zum Blitzableiter für Gesellschaftskonservative geworden, zum Kürzel für alles, was sie als Fehlentwicklungen in unserer Gesellschaft und besonders unseren Schulen ansehen.
Читать дальше