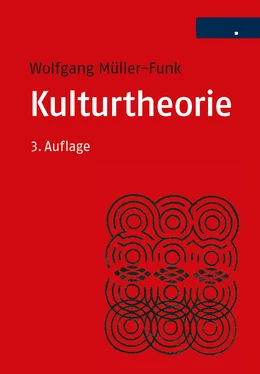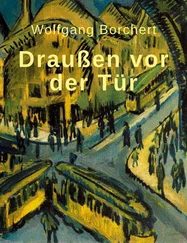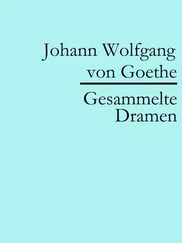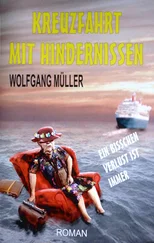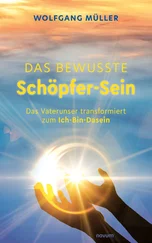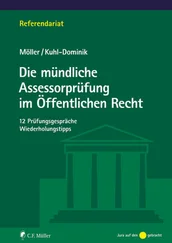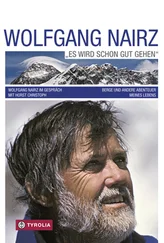Wolfgang Müller-Funk - Kulturtheorie
Здесь есть возможность читать онлайн «Wolfgang Müller-Funk - Kulturtheorie» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Kulturtheorie
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Kulturtheorie: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Kulturtheorie»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Kulturtheorie — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Kulturtheorie», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Wie jeder geniale Titel enthält auch jener der Schrift von 1930 bereits die wichtigsten Elemente der Argumentation. Förmlich ins Auge springen dabei wohl drei Elemente: der Terminus des Unbehagens, die befremdliche Präpositionalkonstrukion „in“ sowie der paradoxe Zusammenhang zwischen Unbehagen und Kultur.
Das Unbehagen, das mit der Vorsilbe „Un-“ die Behaglichkeit negiert, bildet eine konnotative Familie mit Ausdrücken wie ungemütlich, unkomfortabel, unheimisch, unvertraut und – um ein Wort aus einem anderen berühmten Aufsatz von FreudFreud, Sigmund zu zitieren – unheimlich.9 Was durch all diese Worte negiert wird, ist ein Grad von Selbstverständlichkeit: Gemütlichkeit, Behaglichkeit, Heimat. Das Unbehagen, um das es zu gehen scheint, ist also nicht bloß eine intellektuelleIntellektueller, intellektuell Unzufriedenheit, sondern eine tief im Menschen verankerte Disposition, eine innere Verstimmung.
Das wird nicht zuletzt an der außergewöhnlichen Präpositionalkonstruktion „in“ deutlich, die nicht einfach an die Stelle jener geläufigen anderen („an“) tritt. Das Substantiv „Unbehagen“ verlangt üblicherweise ein präpositionales ObjektObjekt, gleichsam ein Attribut. Dieses bleibt im Titel ausgespart, d.h. es fehlt. Das Unbehagen hat gleichsam sein Objekt verloren und man könnte mutmaßen, dass gerade darin das Ungemütliche besteht. Die Präposition „in“ ersetzt die fehlende („an“) nicht, die im KontextKontext mit dem Unbehagen keine wirklich räumlich-lokale, sondern eine metaphorische Bedeutung hat. Demgegenüber verortet die Präposition „in“ das Unbehagen schlechthin. Der Ort dieses Unbehagens ist die Kultur.
Über diesen Umweg kann man schließen, dass dieses Unbehagen, das in der Kultur ist, womöglich auch eines an der Kultur ist.
Kommen wir nun zum dritten Aspekt des Titels: der Gegenüberstellung von Unbehagen und Kultur. Der traditionelle Kulturbegriff legt – übrigens auf allen drei Bedeutungsebenen (Kultur I, II, III → Kap. 1) – die Vorstellung nahe, dass Kultur etwas ist, das Sinn stiftet, sekundäre Heimat schafft, kurzum Behagen produziert. Aber, so suggeriert die Überschrift, das Gegenteil scheint der Fall zu sein.
Oder, um die Pointe vorwegzunehmen: Das, was intentional Behagen erzeugt, schafft paradoxerweise gerade dadurch und zugleich Unbehagen. FreudsFreud, Sigmund mit allen rhetorischen Wassern gewaschener Text10 beginnt aber nun keineswegs mit der Erörterung dieser Frage, sondern betritt sein Thema auf einem Seitenweg. Gegenstand der vorangegangen Abhandlung Die Zukunft einer Illusion (1927) war das Thema ReligionReligion, religiös gewesen. Aus ihr hatte sich eine kontroverse Korrespondenz zwischen dem französischen Schriftsteller Romain RollandRolland, Romain und FreudFreud, Sigmund ergeben. RollandRolland, Romain hatte darauf verwiesen, dass Religion keineswegs bloß eine menschliche Illusion darstelle, sondern auf einer Grunderfahrung, auf einem elementaren „ozeanischen Gefühl“ beruhe, das FreudFreud, Sigmund in seiner Replik mit einem Vers aus Grabbes Drama Hannibal („Ja, aus der Welt werden wir nicht fallen. Wir sind einmal drin.“) kommentiert. Dieses ursprüngliche Einheitserlebnis, das schon in SchleiermachersSchleiermacher, Friedrich D.E. Reden über die Religion (1799)11 eine zentrale Rolle spielte, wird von FreudFreud, Sigmund rundweg in Abrede gestellt:
Die Idee, dass der Mensch durch ein unmittelbares, von Anfang an hierauf gerichtetes Gefühl Kunde von seinem Zusammenhang mit der Umwelt erhalten sollte, klingt so fremdartig, fügt sich so übel in das Gewebe unserer Psychologie, dass eine psychoanalytische, d.i. genetische Ableitung eines solchen Gefühls versucht werden darf.12
Der Einwand des französischen Schriftstellers zwingt zur Selbstpositionierung. Lassen wir einmal dahingestellt, ob das „ozeanische Gefühl“ wirklich schon die Existenz eines Ichs voraussetzt, das „Kunde von seinem Zusammenhang mit der Umwelt“13 hat, oder ob dieses nicht viel eher im Zwischenbereich dessen angesiedelt ist, was FreudFreud, Sigmund mit dem Es und dem Ich bezeichnet. In jedem Fall bezieht FreudFreud, Sigmund systemlogisch, wie er selbst zu Recht feststellt, eine skeptische Gegenposition zur romantischen Annahme ursprünglicher Einheit und authentischen Daseins. Modern an FreudFreud, Sigmund scheint hier, dass er eigentlich von einem nie ganz reparablen Fremd-Sein des Menschen in der Welt ausgeht. Aus FreudsFreud, Sigmund Perspektive kann der Mensch sehr wohl aus der Welt fallen, weil er nie ganz in ihr ist. Gerade weil dies so ist, gewinnt Kultur im Fortgang der Argumentation eine zentrale Rolle.
FreudFreud, Sigmund steht im Einklang mit den Ideen der Denker und Dichter der Wiener Jahrhundertwende – mit MachMach, Ernst, SchnitzlerSchnitzler, Arthur, HofmannsthalHofmannsthal, Hugo von und MusilMusil, Robert –, wenn er konstatiert, dass das Ich keine ursprüngliche Größe und keine selbständige, gegen alles andere abgegrenzte Instanz darstellt.
Es verfügt über keine scharfen Grenzen, nach innen wie nach außen. Verliebtheit ist ein exemplarisches Beispiel dafür, wie die Grenzen zwischen Ich und ObjektObjekt verschwimmen. Viel wichtiger aber ist, dass das Ich im Gegensatz zum Es, dem „unbewusstenunbewusst seelischen Wesen“, eine (Kultur-)GeschichteGeschichte hat. In heutigen Worten formuliert, ist das Ich eine kulturelle KonstruktionKonstrukt, Konstruktion, oder, wie es FreudFreud, Sigmund formuliert, ein Scharnier zwischen Innen- und Außenwelt, zwischen Lustprinzip und Realität. Nun kann FreudFreud, Sigmund die Standardversion des psychoanalytischen Narrativs (→ Kap. 13) erzählen: die GeschichteGeschichte vom Säugling, für den Innenwelt und Außenwelt ungeschieden sind. Das Ich ist das Resultat einer Entwicklung, an deren dramatischem Ausgangspunkt die drohende und bedrohliche Außenwelt steht. Es ist ein Ich, das auf kindliche, unbändige Weise seine Lust gegen die Außenwelt geltend macht und sich gegen diese und deren Zumutungen abgrenzt.
Das „ozeanische Gefühl“ lässt sich anhand dieser ErzählungErzählung(en) als ein Rückgriff auf eine „frühe Phase des Ichgefühls“14 zurückführen, als Tendenz des erwachsenen Menschen, in diesen vermeintlich idyllischen Zustand zurückzukehren. Das Stichwort lautet Regression. Im Gegensatz zum heute geläufigen Wortgebrauch bezeichnet es eine unvermeidliche Rückbewegung, eine imaginäre Rückkehr zur Kindheit, die FreudFreud, Sigmund hier mit dem Erinnern verbindet. Die Regression ist aber auch ein Regress, eine Entschädigung, ein Ausgleich. Diese Vorstellung von Entschädigung ist zentral für FreudsFreud, Sigmund Konzept von Kultur. FreudFreud, Sigmund wendet diesen ontogenetischen Befund phylogenetisch und archäologisch:
Unser heutiges Ichgefühl ist also nur ein eingeschrumpfter Rest eines weit umfassenderen, ja eines allumfassenden Gefühls, welches einer innigeren Verbundenheit des Ichs mit der Umwelt entsprach.15
So interpretiert FreudsFreud, Sigmund biologisch-psychologischer MaterialismusMaterialismus das heutige Ich analog als einen evolutionären Restposten: Das heutige Ich verhält sich zu jenem archaischen Ich, das jedes Erdenkind, auch das moderneModerne, modern, -moderne, noch einmal durchläuft, wie die Echsen zu den Dinosauriern oder das gegenwärtige Rom zur antiken Metropole. In Kultur ist also immer ein Moment von Regression und Regress, von Vergessen und Erinnern eingeschrieben. ReligionReligion, religiös wird dabei als eine ReaktionsbildungReaktionsbildung, als ein kultureller Effekt verstanden, somit als integraler Bestandteil von Kultur. Es basiert auf einer ErinnerungErinnerung an ein ‚primitives‘ Ich und stellt eine Rückkehr zu „uralten, längst überlagerten Zuständen des SeelenlebensLeben, Lebens-, -leben“ dar, in ein Dunkel, das FreudFreud, Sigmund mit Verweis auf SchillersSchiller, Friedrich Gedicht Der Taucher 16 als monströs und unheimlich apostrophiert.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Kulturtheorie»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Kulturtheorie» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Kulturtheorie» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.