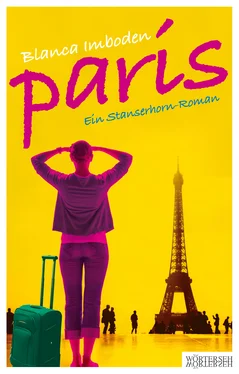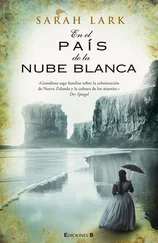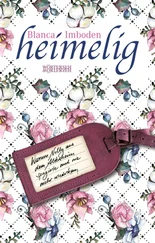»Hat er dich rumgekriegt? Er findet immer ein Opfer.«
»Ist das schlimm?«
»Nicht wirklich.«
Bärbel zuckt mit den Achseln.
Ich reiche dem Jungen sein Los. Er nimmt es dankend entgegen und rennt davon.
»Gib mir doch auch so ein Los«, sage ich spontan und beschließe, auch meinem Glück eine Chance zu geben.
»Echt jetzt?«, wundert sich Bärbel.
»Jawohl. Am besten zwei!«
Sie reicht mir kopfschüttelnd die Lose, und ich gebe ihr eines zurück, nachdem ich bezahlt habe.
»Das ist für dich, Bärbel. Vielleicht hast du ja Glück im Spiel?«
Ich bekomme ein gequältes Lächeln als Antwort, aber sie nimmt das Los und steckt es in ihre Jeans.
Fünf Franken für ein Stückchen Hoffnung, einen kleinen Traum. Man könnte zehntausend Franken gewinnen. Oder im noch besseren Fall, sozusagen als Topgewinn, zwanzig Jahre lang jeden Monat viertausend Franken.
Wahnsinn!
Jeden Monat viertausend Franken!
Vielleicht ist es fünf Franken wert, dieses berauschende Gefühl der Hoffnung auf das große Glück. Wenn man natürlich am Ende eine Niete gezogen hat, dann hat diese Enttäuschung fünf Franken gekostet und war ein schlechtes Geschäft.
Zu Hause bin ich allein. Kein Guido weit und breit. Ich schäle mich aus der Uniform, ziehe Jeans und Bluse an und lege mich auf das Sofa. Meine müden Beine freuen sich. Einfach einen Moment lang liegen. Eine kleine Weile nichts tun. So viel Luxus muss sein nach einem langen Arbeitstag.
Ich muss wohl eingenickt sein, denn ich erwache, als jemand mein Gesicht ableckt. Oder ist das noch ein Stück schräger, abartiger Traum, der mich ins Erwachen begleitet?
Nein! Wäh!
Da ist eine Zunge in meinem Gesicht!
Ich schüttle mich und setze mich auf.
Ein Hund!
Er bellt und wedelt mit dem Schwanz.
Ich putze mir verärgert mit dem Ärmel meiner Bluse die Hundespucke aus dem Gesicht. Was macht der Hund hier? Ich weiß die Antwort schon, bevor sich die Frage in meinem Kopf wirklich breitgemacht hat: Guido hat mal wieder einen Gast aufgenommen. Aus irgendeinem Grund, den er mir bei Gelegenheit verraten wird. Wir hatten schon die unglaublichsten Hausgäste: Springmäuse, eine alte, riesige Echse und eine Zeit lang sogar einen Papagei, der mich wirklich nur genervt hat mit seinem Lärm, seinem Geschnatter, seinem Gehabe. Gut, wenn ich ein Papagei wäre und jemand würde mich in einen Käfig sperren, dann würde ich mich auch rächen und den Leuten im Haus das Leben möglichst schwer machen wollen. Wie kann man Vögel in Käfigen halten?!
Ganz anders dieser Hund hier. Er rennt gerade aufgeregt durchs Haus und scheint sich wohlzufühlen bei uns.
»Guido!«, rufe ich vorwurfsvoll.
Kein Lebenszeichen.
Mein Gatte hat mir einfach einen Hund ins Wohnzimmer gestellt, während ich ein Nickerchen gemacht habe, und ist wieder gegangen? Auch nicht etwas, das ich nicht schon kenne. Als Frau eines Tierarztes trägt man vieles mit.
Jetzt sitzt der kleine Hund wieder vor mir und schaut mich erwartungsvoll an. Was will er? Spielen, essen, Gassi gehen? Vorsichtig streichle ich ihn und schaue mir sein Halsband genauer an.
»Soso, du heißt also Jacky.«
Der Kleine bellt aufgeregt. Sein Name wurde wohl von seiner Rasse abgeleitet. Viel weiß ich zwar nicht von Hunden, aber einen Jack Russell Terrier erkenne sogar ich: kleine weiße Hunde mit ein paar wenigen braunen oder schwarzen Flecken. Jacky hat fast schwarze Ohren und einen Blick, mit dem er wohl von jedem Herrchen immer und zu jeder Zeit bekommt, was er will.
Ich stehe auf, vergesse meine Müdigkeit, hole eine Hundeleine – was bei uns immer vorrätig ist – und mache mich mit dem Vierbeiner auf den Weg nach draußen. Der Abend ist wunderschön. Ich spaziere durchs Dorf zur Praxis von Guido. Immerhin braucht der Gast ja sicher auch noch Futter, und ich möchte schon gern wissen, wie lange Jacky bei uns bleibt.
Wir bummeln durch Stans. Hier kenne ich jede Ecke, jeden Laden, fast jeden Einwohner. Ich grüße und werde gegrüßt, wechsle da und dort ein paar Worte. Man kennt mich als die Frau vom Tierarzt und als die Bähnlerin vom Stanserhorn. In Stans lässt es sich gut leben. Grad genug weit weg von Luzern, damit der Ort nicht ausblutet und sich alles nach Luzern verlagern würde, vom Einkaufen bis zur Kultur. Und doch sehr nahe bei der Stadt, woraus sich endlos viele Möglichkeiten ergeben. Wir haben die Berge, die Hügel, die Wiesen, und der See ist zum Greifen nah.
Guido sehe ich schon von weitem vor seiner Praxis stehen. Vielleicht hat er gerade Feierabend. Das wäre schön. Aber er ist nicht allein. Gloria steht neben ihm. Sie unterhalten sich unverfänglich. Ich sollte da nicht zu viel hineininterpretieren und damit meiner Eifersucht Nahrung geben. Aber ich sehe meinen Mann lachen und scherzen und frage mich, wann er mir gegenüber zum letzten Mal so charmant war, wann er das letzte Mal in einem Gespräch mit mir so gestrahlt hat. Das tut weh.
»Schau mal«, ruft Gloria erfreut, als sie mich mit dem Hund sieht – ich glaube, ihre Freude bezieht sich vor allem auf den Hund –, »schau, da ist ja Jacky!«
Der untreue Hund will sofort nichts mehr von mir wissen, und als ich ihn schließlich loslasse, rast er auf Gloria zu, wedelt, bellt und leckt ihre Hände.
Warum nur fliegen alle auf Gloria?
Sogar Hunde!
Ich bin kurzfristig ein wenig beleidigt.
Guido reagiert ungerührt und sagt, Gloria zugewandt: »Ich habe es dir doch gesagt: Ich wusste nicht, wem der Hund gehört, und weil ich wegmusste, habe ich ihn einfach mal meiner Judith anvertraut.«
Jetzt, wo ich bei ihm angekommen bin, legt er seinen Arm um mich und zieht mich an sich, küsst mich sogar. Wem will er damit etwas beweisen oder sagen? Ich bin verwirrt.
»Schon gut«, winkt Gloria großzügig ab. »Er ist nur zu Besuch. Ein Feriengast sozusagen. Vielen Dank, Frau Flury. Sehr nett, dass Sie sich gekümmert haben.«
Sie reicht mir ihre Hand und mustert mich. Gut, ich mustere sie auch, das gebe ich gern zu. Bei ihr gibt es ja auch etwas zu sehen. In den Reithosen, die sie trägt, macht sie – wie gewohnt – eine gute Figur. Sie hat einen knackigen Hintern, eine beneidenswerte Taille, einen erstaunlichen Busen. Und ihre Haut sieht aus, als wäre sie nie der Sonne ausgesetzt, dabei ist Gloria beim Reiten doch ständig draußen. Keine Ahnung, wie sie das macht. Ich bin immer viel zu braun, sommersprossig, und meine Nase wird gern leicht rot, wofür mich mein Guido ständig neckt. Meine krausen Haare sind schnell ausgebleicht von der ständigen Sonnenbestrahlung, manchmal auch trocken, wie ein Besen, kaum zu bändigen. Glorias schwarz gefärbte Haare sind dagegen straff zu einem Zopf geflochten und geben ihr zartes Gesicht frei.
Gloria ist ein Dornröschen. Oder ein Schneewittchen.
Dagegen bin ich bloß ein fröhlicher, liebenswerter Pumuckl.
Aber immerhin: Sie zieht mit ihrem Jacky von dannen, und Guido spaziert Hand in Hand mit mir heimwärts.
»Wollen wir in der ›Linde‹ essen gehen? Wir könnten ein wenig draußen sitzen, ein Glas Wein trinken? Was meinst du, Judith?«, fragt Guido, und seine Spontanität überrascht mich. »Muss nicht sein, wenn du zu müde bist«, sagt er schnell, weil ich nicht sofort reagiere.
Ich küsse ihn mitten auf der Straße auf die Nasenspitze und sage: »Eine wunderschöne Idee.« Aber ich erlaube mir dann doch zu fragen: »Muss ich mir Sorgen machen wegen Gloria? Gibt es da etwas, das ich wissen muss?«
Eine mutige Frage. Vielleicht auch eine dumme Frage. Schließlich würde er kaum zugeben, wenn da etwas wäre.
Er zuckt mit den Achseln und sagt: »Ja, weißt du, ich glaube … also … sie schleicht schon auffallend oft um mich herum. Keine Ahnung, warum sie sich auf mich eingeschossen hat. Ich mag ja nicht einmal ihre Pferde. Es war gut, dass sie uns zusammen gesehen hat.«
Читать дальше