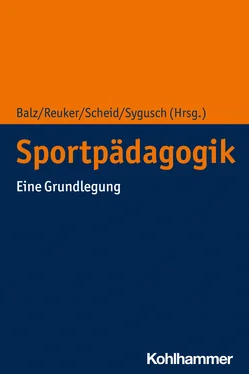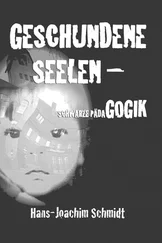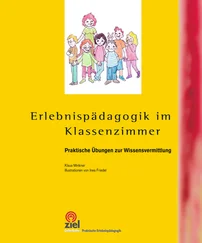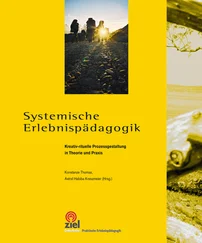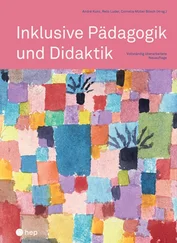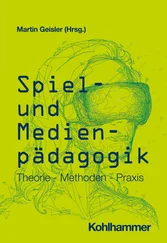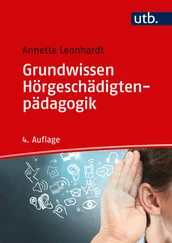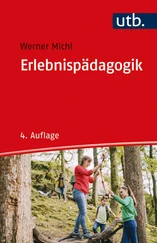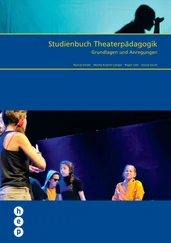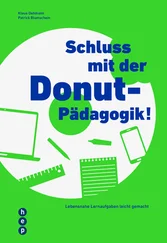Zur Einordnung der Vielfalt an Bildungsorten und -modalitäten im Feld Bewegung, Spiel und Sport hat Heim (2008) im Zweiten Kinder- und Jugendsportbericht eine anschauliche Systematik vorgelegt (siehe hierzu auch Neuber & Golenia, 2019). Unterscheiden lassen sich die Dimensionen formale – non-formale Bildungsgelegenheiten bzw. -settings sowie formelle – informelle Bildungsprozesse. Formelle Bildungsprozesse werden bspw. im Sportunterricht, beim Training im Sportverein oder in einem Tanzkurs angebahnt, also in angeleiteten Lehr-Lern-Settings im Kontext von Institutionen als formalen Bildungsgelegenheiten. Informelle Bildungsprozesse können sich im Rahmen nicht-angeleiteter sportbezogener Aktivitäten ergeben, z. B. bei familiären Sportaktivitäten, beim Inline-Skaten im Skatepark oder auch bei der Teilnahme an Schulsportfesten.
Betrachtet man das Verhältnis der beiden zentralen Grundbegriffe Erziehung und Bildung lässt sich dieses in zweifacher Weise charakterisieren: Zum einen als ein angeleiteter gegenüber einem selbstreferentiellen Prozess. D. h. die Beeinflussung eines Zu-Erziehenden durch einen Erzieher versus einem Sich-Bildens als einem selbstbezüglichen und selbstreflexiven Vorgang. Zum anderen mit Blick auf die Relation der beiden Begriffe: Erziehung bezeichnet eine Einflussnahme auf eine Person, um Bildung zu ermöglichen, im Sinne einer »Erziehung mit dem Ziel der Bildung« (Prohl, 2010). Wenngleich Bildung nicht notwendigerweise an erzieherische Prozesse gebunden ist, sondern fraglos auch außerhalb pädagogischer Kontexte stattfindet (Scherer, 2005).
Zusammenfassend lassen sich folgende zentrale Aspekte zum Bildungsbegriff festhalten:
• Kern der verschiedenen Definitionen des Bildungsbegriffs ist die individuelle Auseinandersetzung mit dem untrennbar verknüpften Selbst- bzw. Weltverhältnis, verbunden mit dem zentralen Moment der Reflexion.
• Hinsichtlich Bildungsorten und -modalitäten lassen sich die Dimensionen formale – non-formale Bildungsgelegenheiten bzw. -settings sowie formelle – informelle Bildungsprozesse heranziehen.
• Mit Blick auf die Abgrenzung der Begriffe Erziehung und Bildung wird insbesondere die Unterscheidung zwischen einem angeleiteten gegenüber einem selbstreferentiellen Prozess deutlich (erzogen werden vs. sich bilden).
• Zur Relation der beiden Begriffe lässt sich festhalten, dass Erziehungsprozesse zu Bildungsprozessen beitragen sollen.
1.3 Entwicklung, Lernen und Sozialisation als Grundbegriffe
Neben den pädagogischen Grundbegriffen Erziehung und Bildung sind Entwicklung, Lernen und Sozialisation weitere zentrale, zunächst wertfreie Begriffe der (Sport-)Pädagogik, die grundlegende pädagogische Sachverhalte betreffen. Nämlich die Tatsache, dass Menschen im Verlauf ihrer lebenslangen Entwicklung vieles erst erlernen (müssen) und in einem gesellschaftlichen Kontext sozialisiert werden. Die Bewertung der Prozesse und des Gelingens von Entwicklung, Lernen und Sozialisation ist wiederum an normative Kategorien gebunden. Einfluss nehmen dabei nicht nur die Menschen selbst durch ihr aktives Handeln, sondern ebenso auch Bedingungen, die von außen, also durch die Umwelt, auf die Prozesse einwirken (Grupe & Krüger, 2007).
Die menschliche Entwicklung ist ein ganzheitlicher Veränderungsprozess, der sich auf motorische, kognitive und psycho-soziale Merkmale bezieht. Im Unterschied zu einem engen, auf traditionellen Phasen- und Stufenmodellen beruhenden Entwicklungsverständnis, das von einer universellen und nicht umkehrbaren Entwicklungsabfolge ausgeht, hat sich spätestens mit dem Aufkommen der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne ein weiter Entwicklungsbegriff durchgesetzt. Nach Trautner (2006) erweisen sich als kleinster gemeinsamer Nenner verschiedener Begriffsbestimmungen die Veränderung und die Zeitachse.
Zu den wesentlichen Bestimmungsmerkmalen eines weiten Entwicklungsbegriffs zählt Trautner (ebd., S. 67–68; auch Willimczik & Singer, 2009) folgende Aspekte:
• Veränderungen über die Zeit, die in einem systematischen Zusammenhang mit dem Lebensalter (Lebenslauf) stehen.
• Überdauernde, langfristige Veränderungen, im Unterschied zu kurzfristigen oder vorübergehenden Veränderungen.
• Regelhafte Veränderungen, die in qualitativen und quantitativen Veränderungen zum Ausdruck kommen (z. B. typische altersbezogene Veränderungen).
• Aber auch nicht regelhafte Veränderungen im Sinne von interindividuellen Unterschieden (zwischen verschiedenen Personen) in intraindividuellen Veränderungen (bezogen auf einzelne Personen).
Bedeutsam ist außerdem die Unterscheidung von Entwicklung als Prozess und als dessen Produkt:
»Der Begriff Entwicklung bezeichnet sowohl den Prozess fortschreitender Veränderungen, einschließlich der ihm zu Grunde liegenden Bedingungen, als auch das jeweilige Produkt dieses Prozesses zu einem bestimmten Zeitpunkt der Entwicklung. Direkt beobachtbar sind immer nur die jeweiligen Produkte des Entwicklungsprozesses. Die zu Grunde liegenden Bedingungen können nur erschlossen werden (z. B. wenn ein systematischer Zusammenhang zwischen vermuteten Entwicklungsbedingungen und Entwicklungsergebnissen besteht)« (ebd., S. 60).
Als lebenslanger Prozess bezieht sich die Entwicklung auf alle Lebensphasen vom Säuglings- bis zum späten Erwachsenenalter. Die motorische Entwicklung steht in einer engen Beziehung zu den Prozessen des Wachstums, der Reifung, des Lernens und der Sozialisation. Von Anfang an haben wir es dabei nicht mit bloßen Reifungs- und Wachstumsprozessen zu tun, sondern mit Anlagen und Potentialen, die sich in der Auseinandersetzung mit den materialen und sozio-kulturellen Gegebenheiten (Entwicklungskontexte) individuell ausbilden und zu erheblichen Unterschieden und Variationen im Entwicklungsverlauf führen.
Die verschiedenen Ansätze zur Beschreibung und Erklärung von Entwicklungsprozessen beziehen sich auf die drei Grundfragen nach dem Gegenstand (motorische, kognitive und psycho-soziale Entwicklung), dem Verlauf und der Steuerung (Person-Umwelt-Bezug) der Entwicklung. Ausgehend von dem Kriterium der Entwicklungssteuerung (Wodurch kommen Veränderungen zustande?) werden vier theoretische Grundpositionen unterschieden: reifungstheoretische, sozialisationstheoretische, konstruktivistische und interaktionale Ansätze (Baur, 1989; Montada, Lindenberger & Schneider, 2012).
Der Zusammenhang von Bewegung und Entwicklung ist für die Sportpädagogik von Bedeutung, weil die menschliche Entwicklung einen wesentlichen Anlass und Bezugspunkt für seine Erziehung darstellt (Dietrich, 1987). Bereits in den 1920er-Jahren stellte Bernfeld (1967) fest, dass Erziehung als Summe der Maßnahmen einer Gesellschaft auf die Tatsache der menschlichen Entwicklung aufzufassen ist. Die zentrale sportpädagogische Frage lautet demnach, wie sich der Mensch im Medium der Bewegung, in der aktiven Auseinandersetzung mit seiner Umwelt allgemein und in den speziellen bewegungskulturellen Ausformungen von Bewegung, Spiel und Sport entwickelt und welchen Einfluss Maßnahmen der Bewegungserziehung und -förderung dabei haben.
Das Feld des Lernens ist ein in der Psychologie sehr intensiv erforschtes Gebiet, das auch ganz wesentlich in die Pädagogik Eingang gefunden hat. Im Unterschied zum Entwicklungsbegriff, der sich sowohl auf die Zu- als auch die Abnahme von Merkmalen bezieht, richtet sich Lernen immer auf einen Zuwachs. Lernen betrifft zudem, im Unterschied zu kurzfristigen Verhaltensänderungen etwa durch Ermüdung und Erschöpfung, überdauernde Verhaltensänderungen, die an die Aktivitäten der Person gebunden sind. Grupe und Krüger (2007, S. 104) definieren den Lernbegriff wie folgt:
»Lernen bezeichnet eine dauerhafte und relativ stabile Änderung der Verhaltensmöglichkeiten, des Wissens und Könnens, der Einstellungen und Gewohnheiten aufgrund von Erlebnissen und Erfahrungen oder auch durch Einsicht. Lernen ist ein aktiver Prozess, der von genetisch weitgehend festgelegten Vorgängen wie Reifung oder Altern zu unterscheiden ist.«
Читать дальше