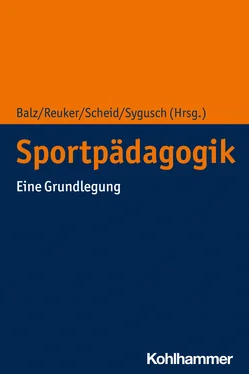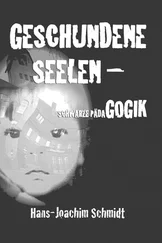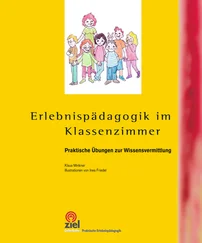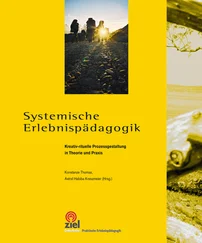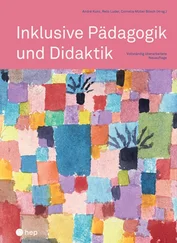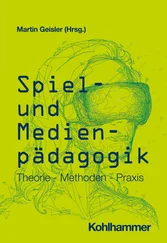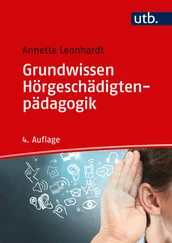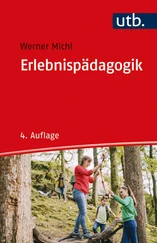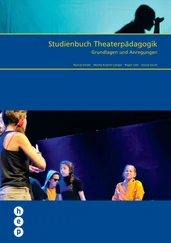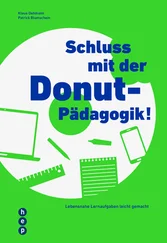1 ...8 9 10 12 13 14 ...21 Die moderne, wissenschaftlich begründete Sportpädagogik griff zwar auf die Antike und auf andere historische Beispiele zurück, z. B. auf das mittelalterliche Ritter- und Turnierwesen, aber man kann erst seit dem 19. Jahrhundert davon sprechen, dass sich ein eigenes Wissens- und Wissenschaftsgebiet herausbildete, im Rahmen dessen nicht nur eine praktisch-methodische Ausbildung sowie Konzepte des Übens und Trainierens in einzelnen Zweigen der Leibesübungen, der Spiele und des Sports erfolgen konnten, sondern zu dem auch die Entwicklung und Diskussion von Theorien und Modellen der sportlich-körperlichen Bildung und Erziehung im Rahmen der Gesamterziehung gehört.
Der entscheidende Impuls für die Entwicklung der Sportpädagogik in Deutschland als einer wissenschaftlichen Fachdisziplin mit breitem praktischem, gesellschaftlich erwachsenem Hintergrund erfolgte im 19. Jahrhundert, und zwar im Zusammenhang mit der Ausbreitung und Entwicklung des Turnens und der Turnbewegung als einem Element nationaler Körper- und Bewegungskultur (Krüger, 1996). Was im 19. Jahrhundert in Deutschland Turnen genannt wurde, konnte in Ziel, Form und Inhalt auf vieles zurückgreifen, was bereits an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert entstanden war und in der Regel mit dem Begriff Gymnastik bezeichnet wurde – auch in Anlehnung an Formen der körperlichen Bildung und Erziehung, die von der griechischen Antike her bekannt waren und als Vorbild für eine neue, aufgeklärte Form der Erziehung angesehen wurden, in der ebenfalls Körperlichkeit und Bewegung eine wesentliche Rolle spielen sollten. Die Pädagogik der Aufklärung und namentlich die philanthropische Bewegung in Deutschland, auf die im nächsten Abschnitt eingegangen wird, stehen am Anfang dieses Prozesses in der modernen Welt.
Inhalte und Strukturen von Theorie und Praxis körperbezogener Bildung und Erziehung änderten sich im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert, als mit dem Aufkommen des Sports und pädagogischer Reformbewegungen, insbesondere seit den 1920er Jahren, die Turnpädagogik und Turntheorie (die Zeitgenossen sagten auch Turnphilologie und Turnwissenschaft) modernisiert und hinsichtlich ihrer Inhalte und Formen transformiert wurden. Ein Paradigmenwechsel hin zur Sportpädagogik und Sportwissenschaft unserer Zeit erfolgte jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg, ab den späten 1960er und zu Beginn der 1970er Jahre, als sich der in den 1920er Jahren begonnene Transformationsprozess fortsetzte und sich schließlich Sport als neuer Leitbegriff der Disziplin durchsetzte. Diese Phase des Übergangs von der Theorie der Leibeserziehung und Sportpädagogik zur Sportwissenschaft ist besonders dadurch gekennzeichnet, dass nun Sport als eigenständiges wissenschaftliches Fach an den Universitäten verankert werden konnte. Dieser Prozess ist in eine allgemeine gesellschaftliche Entwicklung der Verwissenschaftlichung und Pädagogisierung eingebunden (Krüger, 2018).
2.2 Die Anfänge der Sportpädagogik bei den Philanthropen
Ein weiter Begriff von Sportpädagogik beinhaltet prinzipiell alle Formen und Inhalte körperlich-motorischer Ausbildung und Erziehung zu allen Zeiten und in allen Kulturen. In der sporthistorischen und sportpädagogischen Literatur geht man jedoch in der Regel davon aus, dass mit der europäischen Aufklärung und den Philanthropen an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert Theorien zur Gesamterziehung und Bildung des Menschen ersonnen und diskutiert wurden, zu der auch die körperliche Erziehung ihren Teil neben der geistigen und moralischen Erziehung beitragen sollte. Die Pädagogik ist so gesehen eine moderne, handlungsorientierte (Sozial-)Wissenschaft, die erst mit der Rezeption philosophischer Grundschriften der Aufklärung und des Neuhumanismus, etwa von John Locke (1632–1704), Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) oder auch von Immanuel Kant (1724–1804), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) oder Friedrich Schleiermacher (1768–1834), beginnt. Das Wirken des großen Schweizer Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) in Theorie und Praxis von Erziehung und Bildung und dessen Bedeutung für die Pädagogik und auch die Sportpädagogik bis in die Gegenwart ist Bestandteil dieser geistesgeschichtlichen Tradition.
Vor diesem Hintergrund werden in der wissenschaftlich-pädagogischen Literatur zur Geschichte der Leibeserziehung und des Sports die Philanthropen als Begründer und Wegbereiter einer modernen Theorie der Leibeserziehung angesehen. Sie nahmen erstmals und im Unterschied zu älteren Konzepten der Vermittlung spezieller körperlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten die Bildung und Erziehung des Menschen insgesamt in den Blick und gingen dabei – in Anlehnung an Rousseau und auch an die Alten, wie GutsMuths formulierte, also die alten Griechen – von der Körperlichkeit und den Erfahrungen des Menschen über Körper und Bewegung aus. Die Bedeutung der Aufklärungspädagogik für die Herausbildung einer wissenschaftlichen Theorie der Gesamterziehung ist in jüngeren Arbeiten von Schmitt und Böning (2014) und Overhoff (2020) aufgegriffen und hervorgehoben worden. Aus sportpädagogischer Sicht ist die Rolle des Schnepfenthaler Pädagogen Johann Christoph Friedrich GutsMuths (1752–1839) besonders zu betonen, weil er die körperliche Erziehung, die Gymnastik, in den Mittelpunkt seiner Pädagogik stellte.
Dieser für die Geschichte der Pädagogik einschneidende Abschnitt der europäischen Geistesgeschichte wurde jedoch bereits zur Zeit des Humanismus und der Renaissance, als grundlegende Einsichten in die Notwendigkeit und Möglichkeit von Erziehung formuliert wurden, vorbereitet. Diese wiederum knüpften an die klassische, antike Philosophie an, insbesondere an die aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. stammende Schrift von Philostrat Über Gymnastik, die als erste und einzige vollständig überlieferte trainings- oder sportpädagogische Abhandlung angesehen wird und die von dem Altertumswissenschaftler Julius Jüthner 1909 wiederentdeckt wurde. Eine Neuübersetzung legte Kai Brodersen 2015 vor (Philostratos, 2015).
Aber auch Philosophen der Renaissance wie Erasmus von Rotterdam (1469–1536), Michel de Montaigne (1533–1592) oder auch der bedeutende tschechische Pädagoge und Didaktiker Johann Amos Comenius (1592–1670) sind Beispiele für die Vorgeschichte einer modernen Pädagogik, in der die körperliche Bildung und Erziehung Berücksichtigung finden. Dieser – körperlich-motorische – Aspekt der Gesamterziehung, der in der Praxis der Erziehung seit jeher seinen Platz hatte, wurde seit dem frühen 19. Jahrhundert nun auch theoretisch reflektiert und diskutiert; unabhängig davon, dass ihm – häufig – eine geringere Wertigkeit als etwa der geistigen oder moralischen Erziehung zugeschrieben wurde.
In der pädagogischen Reformbewegung der Philanthropen um die Wende von 18. zum 19. Jahrhundert standen zum ersten Mal körperlich-motorische Aspekte der Erziehung im Vordergrund. Körperliche Bildung und Erziehung – und dazu gehörten auch und vor allem körperliche Gesundheit und das Wissen um sie – stellen aus der Sicht Christian Gotthilf Salzmanns (1744–1811), Johann Christoph Friedrich GutsMuths’ (1759–1839), des »letzten der Philanthropen« (Diesterweg), oder auch anderer philanthropischer Pädagogen die Grundlage und den Ausgangspunkt jeder Erziehung dar.
Dieses an der Körperlichkeit des Menschen und seiner Bewegungsfähigkeit ansetzende Erziehungskonzept wurde nicht nur abstrakt und theoretisch formuliert, sondern auch in der Praxis einiger Reformschulen, der sog. Philanthropine – die berühmtesten standen in Dessau und Schnepfenthal –, erprobt und von dieser Praxis ausgehend theoretisch weiterentwickelt. Das Ergebnis war eine bis dahin nicht gekannte quantitative und qualitative Ausdehnung und Differenzierung der Produktion an (sport-)pädagogischer Literatur, von Werbeschriften, Ratgebern, Handbüchern, Katechismen, Methodiken, aber auch allgemeiner philosophisch-pädagogischer Reflexionen. Die Erziehungsphilosophie der Philanthropen bezog sich, in Anknüpfung an die Ideen der Aufklärung, nicht mehr nur auf einen kleinen, elitären Personenkreis, wie dies etwa in der ritterlichen Erziehung und Ausbildung oder in der Erziehung der Höflinge, aber auch in den Meisterlehren des Mittelalters und der frühen Neuzeit der Fall gewesen war, sondern sie ging von der prinzipiellen Gleichheit und Bildsamkeit aller Menschen aus. Omnes omnia omnino – allen ist alles zu lehren – lautet der auf Comenius zurückgehende Lehrsatz der Erziehung im Sinne der Aufklärung und der Philanthropen.
Читать дальше