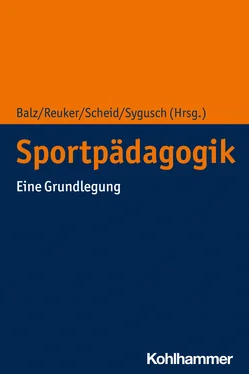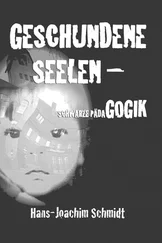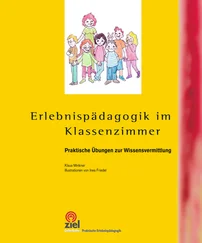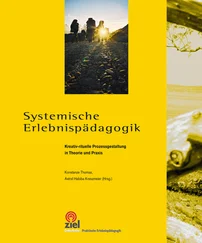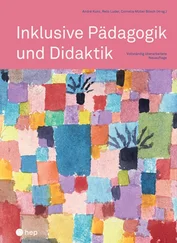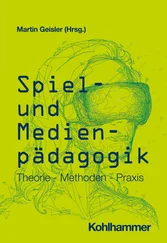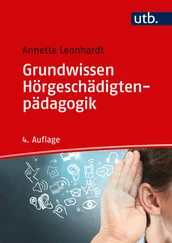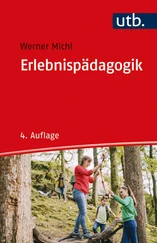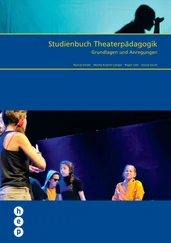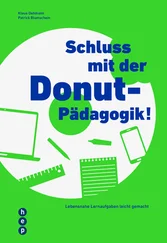Der Aufstieg Englands zur Weltmacht ließ den Sport schließlich zu einem universellen Modell von Leibesübungen werden. Er bildet den Kern der Wettkämpfe und Disziplinen bei Olympischen Spielen. Umgekehrt bekam aber auch der englische Sport erst durch die Olympischen Spiele und den Olympismus eine pädagogische Legitimation. Der internationale Sport wurde mit einer universellen pädagogischen Idee verknüpft.
Der von Pierre de Coubertin (1863–1937) begründete Olympismus war in erster Linie eine pädagogische Idee oder Philosophie (Grupe, 1997). Mit Hilfe des Sports, Coubertin sagte allerdings Athletik und meinte damit einen fair und ritterlich betriebenen Sport, sollte ein Beitrag zum Frieden und zur Solidarität unter den Menschen geleistet werden. Die Olympischen Spiele stellen bis heute das Symbol, aber auch das Bemühen um die Verwirklichung dieser pädagogischen Idee des Sports dar. Die Olympische Charta betont in ihrer Präambel ausdrücklich die pädagogischen Ziele des Olympismus.
In Deutschland erfuhr die Ablösung des turnerischen und gymnastischen Modells der Körpererziehung durch das sportliche und spielerische Modell, durch Sport und olympische Erziehung, eine Ergänzung. Die sog. Jugendbewegung sowie reformpädagogische Ideen und Bestrebungen seit der Jahrhundertwende und besonders in den 1920er Jahren erweiterten das Spektrum der Leibeserziehung (Wedemeyer-Kolwe, 2017). Spielerische Formen von Leibesübungen an der frischen Luft, Turn-, Sport- und Sommerspiele, erfahrungs- und erlebnisorientierte Initiativen und Ansätze in der Pädagogik wie die Arbeitsschul-, Kunsterziehungs- und Landschulbewegung veränderten Inhalte, Formen, Ziele und Konzepte des traditionellen systematischen Turnens. Dafür steht insbesondere der Begriff des natürlichen Turnens, der von den Österreichern Karl Gaulhofer und Margarete Streicher entwickelt, begründet und inhaltlich gefüllt wurde. Der Name war insofern Programm, als die Reform des alten Turnens freiere und natürlichere Formen und Inhalte der körperlichen Erziehung vorsah, die dem Wesen oder der Natur des Kindes eher entsprächen wie das steife Turnen.
In den 1920er Jahren setzte sich im deutschen Sprachraum zunehmend der Begriff Leibeserziehung als Bezeichnung für eine am Körper ansetzende ganzheitliche Erziehung durch. Leibesübungen und Leibeserziehung stellten auf pädagogischem Gebiet sowohl im Ausdruck als auch in ihrer Bedeutung den historischen Kompromiss zwischen Turnen und Sport in den deutschsprachigen Ländern dar. Als Leibeserziehung wurde insbesondere die körperliche und gesundheitliche Erziehung an den Schulen bezeichnet. Sie grenzte sich gegenüber außerschulischen Formen und Inhalten des Turnens und des Sports in Vereinen und in anderen Organisationen ab.
Allerdings darf nicht vergessen werden, dass in den Vereinen und Verbänden schon immer, beginnend in der Deutschen Turnerschaft, aber auch im Arbeiter-Turn- und Sportbund und schließlich auch in den Sportverbänden, die Nachwuchsarbeit systematisch und in ihrer Intensität zunehmend betrieben wurde. Dafür wurde die Ausbildung für Vorturner, Übungsleiter und Trainer nach und nach ausgebaut und verbessert. Mit diesen in den Vereinen und Verbänden seit dem 19. Jahrhundert entwickelten spezifischen Lehr- und Ausbildungskonzepten wurden pädagogische Ziele und Ansprüche verfolgt, wenn auch nicht wissenschaftlicher Art. Heute stellt das Trainings- und Ausbildungswesen der Verbände die zweite große Säule der modernen, angewandten Sportpädagogik, neben der an den Universitäten verankerten, wissenschaftlichen Sportpädagogik und Sportwissenschaft dar, die aus der Theorie der Leibeserziehung hervorging.
Eine explizite Theorie der Leibeserziehung wurde, aufbauend auf den reformpädagogischen Arbeiten der 1920er Jahre, nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich und der Bundesrepublik Deutschland in den 1950er und 1960er Jahren entworfen und auf breiter Grundlage diskutiert. Name und Inhalte dieser Debatte um Aufgaben, Ziele, Inhalte, Methoden und nicht zuletzt um den kulturellen Stellenwert der Leibeserziehung verbreiteten sich seitdem in aller Welt. Die 1956 in der Bundesrepublik von Sportverbänden, Bund, Ländern und Gemeinden verabschiedeten »Empfehlungen zur Förderung der Leibeserziehung an den Schulen« stehen für den in den ersten Nachkriegsjahrzehnten wieder erreichten gesellschaftlichen Konsens über Leibesübungen und Leibeserziehung an den Schulen. Leibeserziehung sollte mehr sein als ein Unterrichtsfach, sondern ein Prinzip der Erziehung im Ganzen darstellen.
2.5 Körperliche Erziehung im Nationalsozialismus und in der DDR
Ein Grund für den Paradigmenwechsel in den späten 1960er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland sowie – mit Abstrichen – ebenso in der Schweiz und in Österreich von der Leibeserziehung zur Sportpädagogik und zum Sportunterricht lag auch darin, dass der Begriff Leibeserziehung durch seine politische Instrumentalisierung im Dritten Reich kaum noch tragbar war. Da eine grundlegende öffentliche und schließlich auch wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in der Bundesrepublik erst seit den 1960er Jahren einsetzte, erfolgte erst vergleichsweise spät, um das Jahr 1970, eine Distanzierung von dem nun in Deutschland als historisch belastet empfundenen Begriff Leibeserziehung. Grundlegend für diese Aufarbeitung der Geschichte des Sports und der körperlichen Erziehung im Nationalsozialismus wurde die 1966 von Hajo Bernett zusammengestellte und kommentierte Dokumentation der Nationalsozialistischen Leibeserziehung (Bernett, 1966; Neuauflage 2008). Von diesem Buch ausgehend entwickelte sich eine intensive Diskussion über den Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in Turnen und Sport.
Die Nationalsozialisten übernahmen jedoch nicht nur den Begriff Leibeserziehung, sondern ergänzten ihn durch das Konzept der politischen Leibeserziehung. Mit dieser auf Alfred Baeumler und Heinz Wetzel zurückgehenden Formulierung wurde einerseits an die reformpädagogischen Impulse der Zwanzigerjahre angeknüpft, aber andererseits wurde zum Ausdruck gebracht, dass Erziehung insgesamt und besonders die körperliche Erziehung im Sinne und gemäß den Vorstellungen der nationalsozialistischen Weltanschauung erfolgen sollte. Dazu gehörte zunächst eine Aufwertung der körperlichen gegenüber der geistigen Erziehung, darüber hinaus eine Orientierung an nationalsozialistischen und rassischen, insbesondere antisemitischen Zielen sowie an der militärischen Erziehung. Dies traf für Jungen und Mädchen prinzipiell auf gleiche Weise zu, wurde aber entsprechend dem nationalsozialistischen Frauenbild differenziert und fand seinen Ausdruck in unterschiedlichen Lehrplänen für die Leibeserziehung für Jungen und Mädchen.
Die Bedeutung, die im Dritten Reich der körperlichen Erziehung und Ertüchtigung, dem Heranzüchten kerngesunder Körper, wie sich Hitler ausgedrückt hatte, beigemessen wurde, zeigt sich zum einen darin, dass die Zahl der verpflichtenden Unterrichtsstunden für Sport an den Schulen zunächst auf drei und dann auf fünf erhöht sowie an den Universitäten Pflichtsport eingeführt wurde. Zum anderen wurde eigens ein Amt K – für körperliche Erziehung – unter Leitung des Leichtathleten und SA-Funktionärs Karl Krümmel geschaffen, in dem alle Angelegenheiten in Sachen körperlicher Erziehung zentralistisch gebündelt und verordnet werden sollten.
Nach dem Ende des Dritten Reichs wurden in Ost- und Westdeutschland unterschiedliche Wege eingeschlagen. Sie wurden von der Politik der alliierten Besatzungsmächte in Deutschland vorgezeichnet. Im Jahr 1949 wurde in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) die DDR gegründet und in den Westzonen die Bundesrepublik Deutschland.
Die Sportentwicklung in der DDR nahm einen ganz anderen Verlauf als in der Bundesrepublik. In der DDR wurde bewusst nicht auf bürgerliche Begriffe wie Leibeserziehung und Leibesübungen zurückgegriffen. Stattdessen verwendete man unter Bezug auf die – kommunistische – Arbeitersportbewegung sowie die Körperziehung in der Sowjetunion die Begriffe Körperkultur und Körpererziehung, als deren Ziel und Aufgabe es angesehen wurde, sozialistische Persönlichkeiten heranzubilden. Aber auch der Begriff des Turnens wurde weiterhin verwendet, insbesondere in den Schulen. Die schulische Körpererziehung war nur ein Teil eines komplexen, von Staat und Partei bestimmten und kontrollierten Systems der Körpererziehung und des Sports. Im Mittelpunkt standen der Leistungssport und die Förderung internationaler sportlicher Erfolge von DDR-Athleten, um einen Beitrag zur Anerkennung und Aufwertung der DDR als zweiter deutscher Staat zu leisten.
Читать дальше