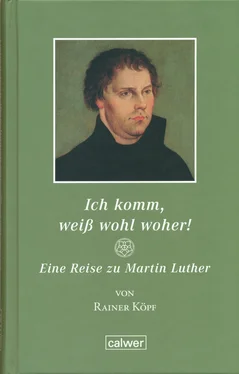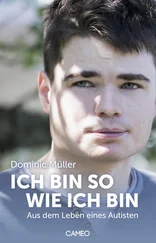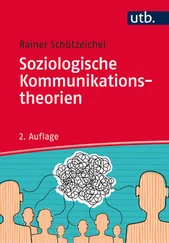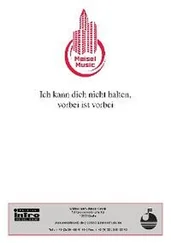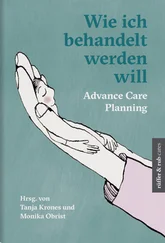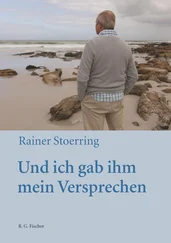Und er versammelt sie alle um sich. Am nächsten Morgen hält er eine Predigt unter freiem Himmel. Auf dem Dorfplatz wollen ihn Hunderte hören. Man kennt sich und weiß voneinander. Es ist ein Heimspiel. Luther steht im Nachrichtenzentrum des Ortes, direkt unter der mächtigen Dorflinde. Hier wurde früher Gericht gehalten. Auch manch politischer Friedensschluss ist unter dem Baum bekannt gegeben worden. Der berühmt gewordene Wittenberger Professor – freilich ein Aufsteiger, aber doch auch „einer von uns“ – verkündigt unter dem Baldachin des Blätterdaches das Evangelium: das Gericht über fromme Werkgerechtigkeit und den Frieden für verängstigte Seelen. Ganz Möhra steht hinter ihm in diesen schweren Stunden vor seiner fingierten Gefangenahme.

Luther predigt in Möhra
Was ist von dieser innigen Beziehung geblieben? Wie stellt sich der Ort dem heutigen Besucher dar?
Die Dorflinde gibt es seit 150 Jahren nicht mehr. Da, wo Luther einst predigte, steht seit dem Jahr 1861 sein fünfeinhalb Meter hohes Bronzedenkmal. Es ist der augenscheinliche Ausgangspunkt einer „neueren“ Luthererinnerung des 19. Jahrhunderts. Die Welt hat in den davorliegenden Jahrhunderten nicht viel von Möhra gewusst. Luthers Stammort lag im Windschatten der Geschichte. Man war hier evangelisch geworden, nicht aus Lokalpatriotismus, sondern weil es der zuständige Kurfürst angeordnet hatte. In manchen eingesessenen Familien mag das Luthergedächtnis wach geblieben sein, aber die Augen der gebildeten Gesellschaft richteten sich auf andere Lutherstätten, vorrangig nach Wittenberg. Die Universität an der Elbe wurde zum blühenden Anziehungspunkt vieler protestantischer Studenten. Über zweihundert Jahre hinweg prägte sie geistiges Leben im reformatorisch gesinnten Europa.
Erst am Ende des 18. Jahrhunderts verändert sich die akademische Wahrnehmung. Der Blick geht weg von den alten Griechen und ihren klassischen Vorbildern. Wissenschaftler und Künstler entdecken die eigene Nation. Die nun einsetzende Zeit der Romantik sucht ihre Ideale nicht mehr im antiken „ausländischen“ Götterhimmel, sondern im Wurzelwerk germanisch-mittelalterlicher Mythen. Das „Kind aus dem Volk“ mit seiner authentischen Reinheit wird zum Gegenstand forschenden Interesses gegen alles „Verbildete“. Das sich emanzipierende Bürgertum sucht seine Identität im eigenen Herkommen. Die Werte der überschaubaren Welt des bäuerlichen Dorfes werden verklärt gegenüber der vermeintlich dekadenten, städtischen Lebensweise des Adels. Das 19. Jahrhundert ist eine Zeit der Ausgräber und Quellensucher. In der Gegenbewegung zur aufkommenden Industrialisierung entdeckt man den „deutschen Wald“ als Ur-Ort des Lebens. Man sucht den geheimnisvollen Zauber verwunschener Plätze in Mooren, Bachläufen und Bergschluchten. „Ad fontes“, der humanistische Ruf „zu den Quellen“, wird in der Romantik zu einem Appell, die Wahrheit nicht in den Tempeln von Peloponnes, sondern im kulturellen Wurzelgrund des eigenen Landes zu finden. Der schwäbische Musikpädagoge Friedrich Silcher notiert die Lieder des einfachen Volkes. Die hessischen Gebrüder Grimm veröffentlichen alte Erzählungen, die die Großmutter noch wusste. Es entstehen gedruckte Sammlungen von Liedern und Sagen. Es ist, als würde ein verschütteter Quelltopf wiederentdeckt, ausgegraben und neu für die Menschen gefasst.
Aus diesem Geist heraus entsteht auch das berühmte „Deutsche Märchenbuch“. Es stammt von dem Meininger Apotheker und Sagenforscher Ludwig Bechstein. Der herzogliche Kabinettsbibliothekar ist ein Universaltalent und wird auch zum Hauptinitiator des Möhraer Lutherdenkmals. Die romantische Sehnsucht braucht Pilgerorte und Symbole, deutsche Helden wie Martin Luther, die aufs Podest der Bewunderung gestellt werden. Bechstein geht voran und ruft eine Spendenaktion ins Leben. Zum 300. Todestag des Reformators 1846 soll die bronzene Skulptur fertig sein. Bechsteins Freund, der Meininger Hofbildhauer Ferdinand Müller, hat sie entworfen. Aber es zieht sich hin. Zwischen ungestümer Anfangsbegeisterung und praktischer Umsetzung liegt der meist lange Weg finanzieller und handwerklicher Realitäten. Als die überlebensgroße Darstellung 1861 in Anwesenheit fürstlicher Vertreter und unter Absingen des Chorales „Ein feste Burg ist unser Gott“ feierlich enthüllt wird, ist Ludwig Bechstein bereits gestorben. Seine Dichterworte aber fassen die Gefühle der Festgesellschaft zusammen und klingen als Rezitation übers Land:
O Möhra, so beglückt und so verlassen .
Du hast ein Recht zu jubeln und zu klagen .
Der arme Bergmann ist davon gezogen .
Im fremden Land vielleicht das Glück zu fassen .
Dir – ward dein Stern im Mutterschoß enttragen .

Lutherdenkmal neben dem Stammhaus
Ist dieses Ehrenmal mit seiner hel- denhaften Gestik und den im Sockel dargestellten biographischen Schlüsselszenen ein idealisiertes Lutherbild, eine überhöhte Heiligendarstellung? Zumindest ist es ein Trostpflaster für die entgangene Ehre, der Geburtsort dieser einmaligen Persönlichkeit geworden zu sein. Den bronzenen Reformator jedenfalls ließen sich die Einwohner Möhras nicht mehr nehmen. Als das Denkmal während des Zweiten Weltkriegs zu Kanonenfutter verwandelt und eingeschmolzen werden sollte, gab es mutige Ortsverantwortliche und gewiefte Beamte,die mit einer behäbigen Verzögerungstaktik die in Berlin befohlene Ablieferung zu verhindern wussten. Diesmal haben sie sich ihren Luther nicht „enttragen“ lassen.
Die Ortsbesichtigung beginnt man am besten hier, im Zentrum des Dorfes, auf dem Lutherplatz, Auge in Auge mit dem denkmalgewordenen Glaubenszeugen. Auf den ersten Blick sieht man schon das Wichtigste:
Luthers rechte Hand zeigt auf ein typisch thüringisches Fachwerkhaus am Lutherplatz Nr. 1. Es ist „Dr. Martin Luthers Stammhaus“. Aller Wahrscheinlichkeit nach war er in diesem Haus des Großvaters mehrfach zu Gast. Es ist der mutmaßliche Geburtsort seines Vaters. Das Gebäude wurde nach einem Brand 1618 von einem Georg Luther wieder neu aufgebaut. 1982 wurde bei einer Renovation der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt. Das Haus ist nicht zu besichtigen, aber zu bewohnen. Wer rechtzeitig bucht, kann in einer der Ferienwohnungen unterkommen.
Am hinteren Ende des Platzes steigt man zum Kirchberg hinauf und betritt durch eine unauffällige Gartentüre den Kirchhof. In freundlicher Anmut steht dort ein ländliches Gotteshaus. Eine kleine Ausstellung befindet sich im Inneren der Kirche. Um das Jahr 1700 erhielt das Gebäude seine heutige Gestalt. Dem Turm wurde die typische „Thüringer Haube“ als Dach aufgesetzt. So schön die Vorstellung gewesen wäre, dass Hans und Margarethe Luder hier geheiratet haben, so fand deren Vermählung tatsächlich wohl aber in der stattlichen Wehrkirche im Filialort Ettenhausen statt, der damaligen Hauptkirche des Kirchspiels. Sie stand für Brautmessen größerer Familien zur Verfügung. In Möhra selbst gab es nur eine kleine Kapelle. Ein Ort des Gebets und der Seelenmessen für Verstorbene, vielleicht auch für Taufen. Dieser bescheidene Andachtsort entsprach in der Größe ungefähr dem heutigen Chorraum. Die steinerne Tischplatte auf dem Altar mit den fünf eingehauenen Weihekreuzen stammt noch aus dieser Zeit. Viel später dazugekommen sind die bunten Bleiglasfenster, die ein Medizinalrat Luther aus Luckenwalde gespendet hat. Dass man sich auf Lutherland bewegt, zeigt auch der Gang über den angrenzenden Friedhof. Wer die Namen der Verstorbenen liest, wird fündig werden.
Читать дальше