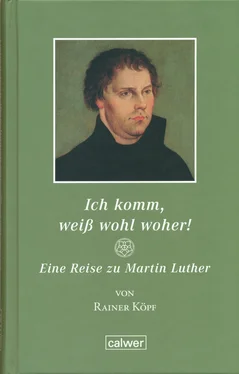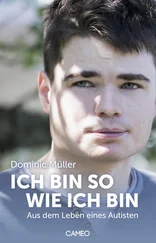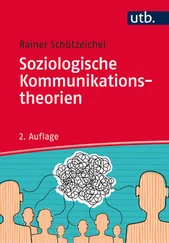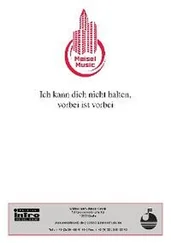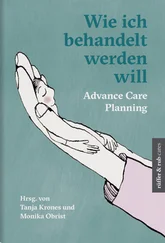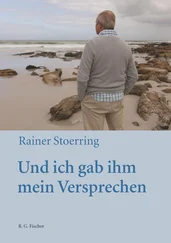Rainer Köpf - Ich komm, weiß wohl woher!
Здесь есть возможность читать онлайн «Rainer Köpf - Ich komm, weiß wohl woher!» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Ich komm, weiß wohl woher!
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ich komm, weiß wohl woher!: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ich komm, weiß wohl woher!»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Zugleich ist das Buch ein praktischer Wegbegleiter für alle, die sich auf eine eigene Reise auf den Spuren Luthers begeben wollen.
Mit einem Reisevorschlag durch das Luther-Land!
Ich komm, weiß wohl woher! — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ich komm, weiß wohl woher!», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
„Diese Klosterkirche stand kurz vor dem Abbruch. Es gab hier keine Gemeindegottesdienste mehr. Niemandem schien sie mehr wichtig zu sein. Doch die Wende kam genau rechtzeitig. Mit westlicher Finanzhilfe konnten wir sie erneuern. Örtliche Hände haben sich motivieren lassen zur Mithilfe. Heute gibt es ein wöchentliches Friedensgebet, regelmäßige Konzerte, vierteljährliche Gottesdienste. Die Kirche beginnt wieder zu arbeiten. Ich bin dankbar für den Wohlstand, der aus dem Westen kommt, aber er wärmt nicht die Herzen. Auch unsere Seelen brauchen eine Heimat. Die Menschen werden wiederkommen. Hier wurde achthundert Jahre lang Gottes Wort verkündigt, und ich bin gewiss, dass dies auch noch in achthundert Jahren so sein wird.“
Und dann erinnert er uns an die reformatorische Tradition und an das reiche Erbe dieser Region, und es war, als wäre es in ihm lebendig geworden, als gehöre er zu denen, die das Feuer des Glaubens weitertragen, weil er mit Luther weiß: „Wir sind es doch nicht, die da die Kirche erhalten könnten. Unsere Vorfahren sind es auch nicht gewesen. Unsere Nachfahren werden’s auch nicht sein; sondern der ist’s gewesen, ist’s noch und wird’s sein, der da sagt: ‚Ich bin bei euch alle Tage bis der Welt Ende . ‘“ Aus den hoffnungsvollen Augen dieses Mannes hat ein trotziges Dennoch gefunkelt, das an Luther erinnert. Plötzlich leuchten die Steine, und durch den Staub der Geschichte funkelt das Gold des Evangeliums. Der glaubensgewisse Superintendent hat uns bei seiner Kirchenführung die toten Steine lebendig gemacht. Was zu kalter Leblosigkeit geronnen erschien, begann plötzlich durch seine Worte zu wärmen.
Dasselbe Anliegen verfolgt dieses Buch. Auf dem Hintergrund seiner Wohnorte wird Luthers Leben erzählt. Dem schweigenden Vergessen wird das „Schreien der Steine“ (Lukas 19,40) entgegengestellt. Luthers Lebensstationen sollen transparent werden für seine theologischen Entdeckungen und die aktuelle Relevanz seiner Gedanken.
Bei Luther lernen wir, dass religiöse Gleichgültigkeit keine moderne Erscheinung ist. In einer Predigt über die Freude auf das ewige Leben zitiert Luther ein Stammtisch erprobtes mittelalterliches Gedicht von Martinus von Biberach. Es nimmt das unbekümmerte Lebensgefühl vieler Zeitgenossen auf und wurde später von Bertolt Brecht zitiert:
Ich komm – weiß nit, woher .
Ich geh – weiß nit, wohin .
Mich wundert, dass ich fröhlich bin .
Luther lehnt diesen Spruch als „Reim der Gottlosen“ ab. Die Christen lebten doch genau in der umgekehrten Situation. Sie kennen Ursprung und Ziel ihres Lebens. Und trotzdem hätten sie oft Angst in der Welt. Deswegen hat Luther daraus ein ermutigendes Gegengedicht gemacht:
Ich komm – weiß wohl, woher .
Ich geh – weiß wohl, wohin .
Mich wundert, dass ich traurig bin .
Deswegen gefällt mir mein vergoldeter „Büro-Luther“. Die Worte des Reformators sind für mich wie ein erquickender Strom mitten in Wüstenzeiten, ein Aufruf zur Zuversicht, wenn die Anfechtung groß ist.
Vorschläge für Stadtrundgänge von Möhra bis Eisleben sind mit einem grauen Strich auf den jeweiligen Seiten markiert .
Möhra
Zur Quelle
Man kann das Leben Martin Luthers mit einem Fluss vergleichen. Mal wild und sprudelnd in den Kämpfen der jungen Jahre, dann wieder in sich ruhend dahingleitend an hellen Sonnentagen, wenn das „Evangelium seinen Lauf“ von ganz alleine tut. Reißende Stromschnellen und gefährliche Untiefen, wenn er wie ein Getriebener hastend fortgerissen wird vom Gefälle der sich verändernden Zeiten. Zum Ende hin dann ein breiter Strom, eine fast melancholische Schwere. Das Fließen wird langsamer, manchmal wie träge stehendes Wasser. Doch es gibt kein Zurück.
Da sind die vielen Rinnsale und Bäche, die den Fluss auf den Weg gebracht haben: eine herausfordernde Erziehung durch die Eltern, die gründliche Schulausbildung, klärende Zeiten im Kloster und an der Universität. Da sind menschliche und geistliche Lernerfahrungen, welche die ausgetrockneten Bachläufe seiner Existenzfragen tropfenweise angefüllt haben. Und dann die große Unterbrechung, wie ein vulkanisches Geschehen unmittelbar aus dem Herzen Gottes heraus: Er entdeckt die voraussetzungslose Gnade des himmlischen Vaters. Er macht die bestürzende Grunderfahrung des geschenkten Daseins. Für Luther war das nicht nur ein geistiges, sondern vielmehr ein alle Lebensadern umfassendes schöpferisches Ereignis. Er hat das Paradies erlebt und zittert vor glücklicher Erschütterung. Als ob ein Erdbeben ihm ein ganz neues Flussbett aufgerissen hätte, den Weg in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes.
Dieser Strom verändert die deutsche Landschaft. Er ordnet mit seiner Fließrichtung die ganze Welt neu. Wie eine Kultur schaffende Lebensader ziehen Luthers Leben und Denken die Menschen in ihren Bann. Die Reformation prägt die westliche Gesellschaft über Jahrhunderte hinweg. Flüsse stiften Identität.
Vergleicht man also Luthers Leben mit einem Fluss, dann liegt hier im beschaulichen Möhra dessen Quelle. Hier fängt seine Familiengeschichte an. Hier steht das Stammhaus der Luthers.
Zur Welt gekommen ist der kleine Martin zwar woanders. In Eisleben, im östlichen Harzvorland, rund 160 Kilometer nordöstlich von hier. Sein Vater Hans war dort mit der Familie auf der Suche nach einer neuen beruflichen Existenz kurzzeitig untergekommen. Im Mansfelder Land boomte damals das frühindustrielle Wirtschaftsleben. Mit seiner hochschwangeren Frau war er hier angelangt. Eisleben ist eher zufällig zum Geburtstort geworden. Die Beziehungen dorthin gehen nicht in die Tiefe. Ein dort ansässiger Onkel der Mutter ist der Anknüpfungspunkt. Die Bande zu diesem Ort sind eher oberflächlich episodenhaft.
Gezeugt jedenfalls könnte Martin Luther hier in Möhra geworden sein, der jahrhundertelangen Heimat seiner Vorfahren. Frisch verheiratet haben seine Eltern wohl noch manche Zeit im Haus des alten Vaters Heine Luder verbracht, bevor sie sich auf den Weg in die weite Welt gemacht haben ins Mansfelder Land. Hier in Möhra, auf der Westflanke des nördlichen Thüringer Waldes, ist der Lebensraum des Lutherclans. An den Quellen dieser Landschaft wurzelt ihr starker Stamm.
Bereits um das Jahr 1300 herum findet sich in Möhra ein Wigand von Lüder. Ritter soll er gewesen sein und aus Großenlüder bei Fulda stammen. Ist er zum Ahnherrn des Reformators geworden? Eine adlige Herkunft? Namen erschlossen sich im Mittelalter nicht vom Schreiben, sondern vom Hören her. Es gab keinen Duden, der die orthographische Richtigkeit eines Begriffes bestätigte. Die meisten Menschen konnten nicht lesen. Ob Lüder, Luder, Ludher oder Luther, ob hessisch, thüringisch oder sächsisch – je nach Mundart klang es stets ein wenig anders, aber alle wussten: Das ist ein und dieselbe Person. Auch Martin Luther selbst hat seinen Namen mindestens auf drei verschiedene Weisen geschrieben. Und das Wörtchen „von“ charakterisierte damals nicht unbedingt eine adlige Herkunft. Es hatte vor allem einen ortsanzeigenden Charakter und konnte auch sagen: Wigand, der „von“ dem Ort „Lüder“ herstammt.
Auch Ortsnamen veränderten sich. Möhra hieß früher einfach nur „Moor“. Das erinnert an die namensgebende geologische Landschaft, ein ausgedehntes Feuchtgebiet, das auch im Namen der heutigen Großkommune weiterlebt. „Moorgrund“ nennt sich der Gemeindeverband, zu dem Möhra mit seinen rund 600 Einwohnern seit 1994 gehört.
Durch seine Nord-Südlage liegt das Mittelgebirge des Thüringer Waldes wie eine 150 Kilometer lange Staumauer frontal zur Hauptwetterseite. Es regnet überdurchschnittlich viel. Aus Sümpfen werden Moore. Die kargen Böden können nur wenige Menschen ernähren. Der mühevolle Lebenskampf, der manchmal wie ein Fluch auf dem Land lastete, konnte aber auch Segen bedeuten. Zum einen sagt Luther einmal rückblickend: „Anstrengungen machen gesund und stark.“ Segen ist nicht nur das Geschenkte, sondern auch das Erworbene, auch die Erfahrung des Bewältigens von Problemen durch eigene Kraft. Und dann: Wer angesichts solcher herausfordernden Lebensbedingungen freiwillig hierher zieht, dem muss man schon etwas bieten. Von der Grundherrschaft her müssen attraktive Autonomie- und Besitzrechte garantiert werden, die das Siedeln und Bleiben in diesem herben Gebiet fördern.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Ich komm, weiß wohl woher!»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ich komm, weiß wohl woher!» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Ich komm, weiß wohl woher!» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.