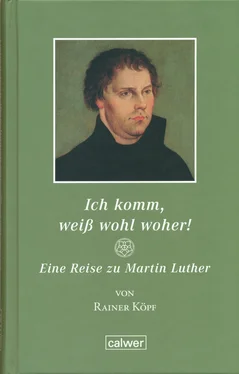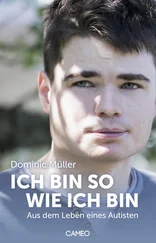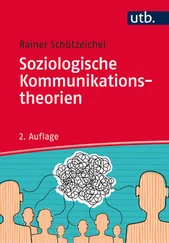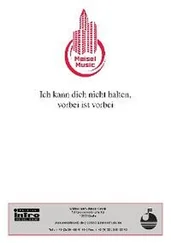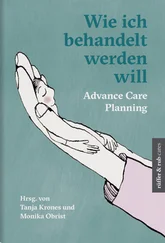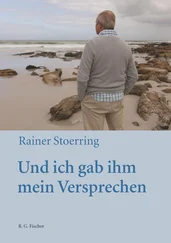Rainer Köpf - Ich komm, weiß wohl woher!
Здесь есть возможность читать онлайн «Rainer Köpf - Ich komm, weiß wohl woher!» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Ich komm, weiß wohl woher!
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ich komm, weiß wohl woher!: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ich komm, weiß wohl woher!»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Zugleich ist das Buch ein praktischer Wegbegleiter für alle, die sich auf eine eigene Reise auf den Spuren Luthers begeben wollen.
Mit einem Reisevorschlag durch das Luther-Land!
Ich komm, weiß wohl woher! — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ich komm, weiß wohl woher!», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
So entstand im Thüringer Wald eine relativ freie, selbstbewusste Bauernschaft, die nur einen weltlichen Patron über sich kannte, den sächsisch-thüringischen Kurfürsten. Die hiesigen Landwirte mussten nicht vielen Herren dienen, wie ihre Berufskollegen in Süddeutschland, von woher im späteren Bauernkrieg die stärkste revolutionäre Sprengkraft kam. Sie waren keine Leibeigenen, die von den Erwartungen ihrer Besitzer schier erdrückt wurden. Der Kurfürst verlangte nicht viel mehr als den jährlichen Gulden für ein Zugviehgespann, eine Art Maschinensteuer. Dazu eine überschaubare Abgabe für Haus und Hof. Das war bezahlbar. Der Freibauer war nicht am Fürsten festgekettet. Er durfte den Wohnort wechseln und besaß das damals nicht selbstverständliche Recht, sich die Ehefrau ohne obrigkeitliche Mitsprache aussuchen zu dürfen. Eigenständig waren die hiesigen Bewohner auch in der Bewirtschaftung der Allmenden, der gemeinsamen kommunalen Güter. Wald, Weide und Wasser wurde ohne Zutun des Grundherrn untereinander verteilt. Auch kleinere Rechtssachen durften auf gemeindlicher Ebene entschieden werden. Ein Dorf mit einem hohen Maß an politischer Selbstbestimmung.
Bei aller Freiheit, die den Möhraer Bauerngeschlechtern gewährt wurde: Eine juristische Bedingung gab es. Das Erbe durfte nicht geteilt werden. Der Hof musste am Stück an die nächste Generation weitergegeben werden. Erbberechtigt war immer der jüngste Sohn.
Nur wenn der Hof beieinanderbleibt, kann eine Familie davon existieren. Und dass gerade der jüngste Sohn erben sollte, war weitsichtig. Die Eltern konnten somit den Hof relativ lange selber bewirtschaften und die Kinder als Arbeitskräfte in ihrer Obhut behalten. Dadurch war es ihnen möglich, sich um deren weitere Versorgung nachhaltig zu kümmern. Denn von welchen Gütern leben die übrigen, die nicht-erbberechtigten Geschwister?
Wer nicht auf andere Bauernhöfe „einheiraten“ oder sich eine eigene kleine Existenz aufbauen konnte, der diente als Knecht oder Magd beim Bruder auf dem elterlichen Hof. Einige der leer ausgegangenen Geschwister verließen aber auch ihre Heimat auf der Suche nach Arbeit und Brot. Der Abwanderungsdruck war groß in Gegenden, in denen das so genannte Anerbenrecht herrschte.
Diese harte Erbregelung war der Preis dafür, dass den bestehenden Höfen eine effiziente, wirtschaftliche Existenz bewahrt wurde und führte dazu, dass die Familien über Generationen hinweg sehr beständig auf ihren Höfen saßen. Die Sippschaft des Reformators zeigt sich als eine überaus ortsgebundene Familie. Im Jahr 1531 sind es mindestens vier Familien „Luder“, die in Möhra wohnen. Sie halten ihre Stammhäuser jahrhundertelang in Familienbesitz. Auch in den umliegenden Gemeinden ist der Name vertreten. Martin Luther sagt einmal, dass seine Verwandtschaft „fast die ganze Gegend einnehme “. Und dieser Eindruck gilt bis heute. Waren in vielen Regionen Deutschlands durch den Dreißigjährigen Krieg ganze Bauerngeschlechter ausgelöscht oder von ihren Dörfern vertrieben worden, so haben sich die Luthers am Ort behauptet. Im Telefonbuch des Jahres 2013 findet man für die Gemeinde Moorgrund noch neun verschiedene Anschlusspartner mit dem Namen „Luther“.
Zur bodenständigen Stabilität kommt die finanzielle Solidität. Aus Steuerlisten geht hervor, dass Luthers Großvater Heine und die mit den Luthers verschwägerten Familien Ziegler, Parchelt, Eckhardt und Kehr zu den sieben reichsten Bauern des Dorfes gehören. Innerhalb der örtlichen Honoratiorenschicht verehelicht man sich untereinander. Es geht nach dem Motto frommer Lebenstüchtigkeit: „Gott hat sie zusammengeführt, aber die Äcker liegen auch beieinander.“ Aus deren Häusern kommen die Entscheidungsträger des Ortes: ehrenamtliche Bürgermeister, Räte und Dorfrichter. Martin Luther bekennt einmal, dass er selber, wenn sein Vater nicht nach Mansfeld gezogen wäre, in diesen Tätigkeiten seine Bestimmung gefunden hätte: „Ich hätte eigentlich ein Vorsteher, Schultheiß und was sie sonst im Dorf haben, irgendein oberster Knecht über die anderen, werden müssen .“ In solchen Familien ist man gewohnt, Verantwortung für das Gemeinwohl zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und Vorbild für andere zu sein.
Martins Vater Hans war nicht erbberechtigt. Er scheint der älteste der vier Luder-Buben gewesen zu sein. Heinz war der jüngste Sohn des Heine, der designierte Hoferbe. Was bekam der Erstgeborene? Gab es für ihn eine berufliche Perspektive?
Aufschlussreich ist, dass die Familie Eigentumsanteile an einer Mühle besaß, die zwischen Möhra und Ettenhausen lag. Ursprünglich war es eine Kupfermühle. Zahlreiche aufgelassene kleine Bergwerke zeigen, dass es durch das ganze Mittelalter hindurch Versuche gab, im Thüringer Wald Eisen, Kupfer und andere Mineralien zu gewinnen. Doch die Bemühungen blieben meistens enttäuschend. Die Erträge deckten oft nur die Binnenbereiche des regionalen Eigenbedarfs ab. Das Kupfererz war von schlechter Qualität. Es lohnte sich nicht mehr. Als das Mühlengebäude später verkauft wird, ist zu erfahren, dass in den 1480er Jahren aus der ehemaligen Kupfer- eine Getreidemühle geworden war. Die Umwandlung von der Metall- zur Kornverarbeitung geschah ungefähr zu der Zeit, als Hans ins Mansfelder Hüttenrevier ausgewandert ist. Ist das ein Zufall? Hat er sich vielleicht bereits als junger Erwachsener in einer Art Nebenerwerbstätigkeit den Geschmack und die Kenntnisse geholt für sein weiteres berufliches Fortkommen als Bergmann? Hätte er vielleicht, bei guten Umständen, die Mühle und das Hüttengewerbe übernommen? Und wollte er nun dorthin, wo der Kupferabbau lukrativer zu sein schien? Das junge Ehepaar verließ jedenfalls die Gegend. Der zukünftige Reformator wurde im Mutterleib davongetragen.
Aber Martin Luther ist später gerne hierher zurückgekommen. Er hat sich seines Möhraer Familienclans nicht geschämt. Als er die weiterführende Schule besucht und zu diesem Zweck ins nahe Eisenach umzieht, pflegt er Kontakt hierher. Ein dreistündiger Sonntagsspaziergang führt den Lateinschüler von seiner Lehranstalt aus leichtfüßig zu seinen Cousins und Cousinen hinter dem Wald. Vorbei an der Wartburg steigt ein Seitenpfad des Rennsteigs munter hinauf in den Thüringer Wald. Nobelpreisträger Thomas Mann schwärmt davon, dass die Natur hier „immer schöner, bedeutender und romantischer“ wird. Man gelangt durch das Dickicht des Gehölzes in die Weite des Moorgrundes. Der Wanderer wird von „freundlichen Haufendörfern aus Fachwerkhäusern“ sonnig begrüßt. Für den städtischen Teenager ist es eine fröhliche Landpartie. Ein Stück Heimat abseits des fernen Mansfelder Elternhauses.
Luther redet positiv über seine Verwandtschaft. Seinem Landesherrn bekennt er später, dass die hiesige Familie ihm „geholfen hat “. Selbst als er bereits deutschlandweit bekannt ist, stellt er sich vorbehaltlos zu seinen bäuerlichen Angehörigen und verwendet sich beim Kurfürsten für den in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Onkel Heinz. Dieser würde gewiss „tun, was er für diesen Hof schuldig ist “. Luther bürgt für ihn und macht deutlich: Ich kenne ihn. Er wird seinen fälligen Kredit baldmöglichst begleichen. Offenbar war Heinz durch außergewöhnliche Umstände in Zahlungsrückstand geraten.
Am besten dokumentiert ist Luthers Aufenthalt in Möhra am 4. Mai 1521. Diese Sternstunde der Ortsgeschichte ereignet sich auf dramatischem Hintergrund. Mit dem Pferdewagen vom Rhein herkommend hat er bewegende Erlebnisse im Gepäck. Auf dem Wormser Reichstag hatte Luther öffentlich das Evangelium bezeugt, sich geweigert, seine Lehren zu widerrufen und war verurteilt worden. Vom Papst gebannt und vom Kaiser geächtet befindet er sich nun fast schutzlos auf der Rückfahrt nach Wittenberg. Unterwegs erreicht ihn eine durch Boten überbrachte Einladung zum Besuch seiner Verwandtschaft. Wer steckt dahinter? Gibt es eine kurfürstliche Regieanweisung für diesen Umweg? In Eisenach verlassen er und seine immer weniger werdenden Begleiter den breiten Heerweg, die Hauptstraße nach Gotha. Der Wagen biegt ab Richtung Südosten. Auf unübersichtlichen Seitenpfaden geht es weiter durch baumreiches, bergiges Gelände. Möhra kommt in Sicht. Von dort aus würde er morgen weiterreisen. Bei der Steige des Steinbacher Glasgrundes, zwei Wegstunden entfernt von hier, wenn die Pferde langsamer werden, würden sie ihn dann in Schutzhaft nehmen und auf die Wartburg bringen. Die Bergfeste seines Landesherrn würde zum Kavaliersgefängnis, zum rettenden Exil werden. Aufregende letzte Stunden vor der geplanten Hilfsoperation seines Schutzherrn Friedrichs des Weisen. Wie gut tun einem in Zeiten der Anfechtung die vertrauten, kampffreien Räume. Der Hof des Onkels. Ein warmes Willkommen. Das stärkende Essen. Eine sichere Schlafstatt. Wohltaten für Leib und Seele. Als ob sich der prominente Durchreisende in dieser Heimatlosigkeit noch einmal seiner Wurzeln versichern wollte, ein Rasten des Hastenden. Er holt sich Kraft an der erfrischenden Quelle des familiären Zusammenhaltes.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Ich komm, weiß wohl woher!»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ich komm, weiß wohl woher!» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Ich komm, weiß wohl woher!» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.