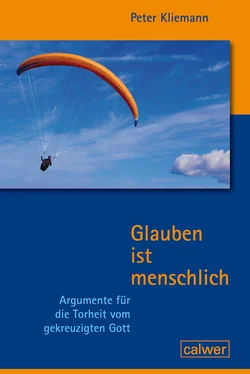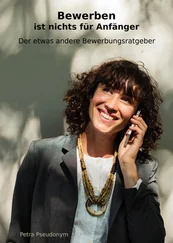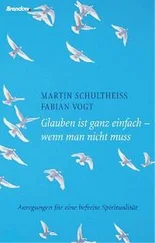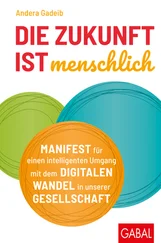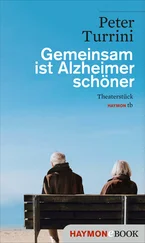1 ...6 7 8 10 11 12 ...18 »Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!« Gal 5,1
Nietzsches Hass gegen das Schwache ist mit dem biblischen Gottesglauben unvereinbar.
→ Auf der Seite der Armen und Entrechteten
Bei allem Verständnis für Nietzsches Kultur- und Religionskritik wird sich christlicher Glaube aber vor allem an einem Punkt ganz klar von Nietzsche abgrenzen müssen: Die bei Nietzsche gedanklich zumindest angelegte und von drittklassigen Epigonen z.B. im sogenannten Dritten Reich in Massenmord umgesetzte Vernichtung der Schwachen und Wehrlosen wird sich niemals und in keinem Zusammenhang mit dem Glauben an den Gott vereinbaren lassen, von dem es heißt: »Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen« (Jes 42,3). Der Gott der Bibel zeigt sich in allen Schichten der Bibel immer wieder als ein Anwalt der Schwachen, Hilflosen und Entrechteten, und er erwartet ebendiese Haltung auch von denen, die an ihn glauben. Der christliche Glaube geht deshalb auch davon aus, dass hilfreiche Zuwendung zum Nächsten nicht geheuchelt sein und auch nicht auf Kosten der Selbstentfaltung des Einzelnen gehen muss. Denn es heißt in der Bibel nicht »Du sollst deinen Nächsten lieben statt dich selbst!« sondern »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!« (Mk 12,31 par; 3. Mose 19,18).
Noch einmal: Kann man die Existenz Gottes beweisen?
Fazit: a) Feuerbach, Marx und Nietzsche haben das Christentum auf Fehlentwicklungen aufmerksam gemacht.
Versucht man, aus dieser Auseinandersetzung mit ausgewählten Positionen des neuzeitlichen Atheismus ein Fazit zu ziehen, dann wäre zunächst festzustellen, dass das Christentum durch die Kritik von Feuerbach, Marx und Nietzsche auf Schwächen und Fehlentwicklungen aufmerksam gemacht wurde, die sonst wahrscheinlich noch lange unausgesprochen und unkorrigiert geblieben wären. Man könnte also sagen, dass die genannten Philosophen, aber natürlich auch andere, dem Christentum in geradezu prophetischer Art und Weise behilflich waren. Sie haben die christlichen Kirchen und die christliche Theologie mit Nachdruck an den Kern ihres Glaubens erinnert.
Der christliche Glaube ist ihnen deshalb zu Dank verpflichtet.
b) Die Existenz Gottes ist nicht beweisbar, sie ist aber auch nicht widerlegbar.
Darüber hinaus sollte aber deutlich geworden sein, dass man mit logischen Argumenten die Existenz Gottes ebensowenig beweisen wie widerlegen kann. Beides, die Existenz wie die Nicht-Existenz Gottes, ist logisch möglich, und es kann nur um die Frage gehen, auf welche Sicht der Wirklichkeit sich der Einzelne in seinem Leben aus welchen Gründen praktisch einlassen, d.h. wiederum, woran er »sein Herz hängen« will.
Das, was für oder gegen den Gottesglauben bzw. den Atheismus spricht, lässt sich in vernünftiger Diksussion gegeneinander abwägen, und man kann auch anhand von Biografien und Lebensbildern einigermaßen plausibel machen, wie der Gottesglaube oder der Atheismus sich im konkreten Lebensvollzug des Einzelnen und der Gemeinschaft auswirken können. Die Entscheidung für oder gegen Gott oder auch die Entscheidung, das Thema zu verdrängen oder sich bewusst nicht zu entscheiden, muss jedoch jeder für sich selbst treffen.
Die Bibel will, dass der Mensch sich entscheidet.
Dass der Mensch sich entscheiden soll und dass seine Entscheidung nicht bedeutungslos ist, ist dabei allerdings ein zentrales Anliegen der biblischen Tradition. Der Weg zum rechten Glauben kann in der Bibel sehr lang und kompliziert sein (vgl. z.B. die Biografie des Mose); er kann mit Verweigerung und Auflehnung gegenüber Gott verbunden sein (vgl. z.B. Jona oder Hiob); er enthält oft auch ein Element der Unsicherheit und des Zweifels (vgl. z.B. Mk 9,24; Joh 20,24ff.) – aber schließlich muss der Mensch sich doch entscheiden, und zwar nicht nur halbherzig, sondern ohne Wenn und Aber (vgl. dazu Lk 9,57–62). Die Offenbarung des Johannes drückt es in ihrem Sendschreiben an die kleinasiatische Gemeinde Laodizea sehr drastisch aus: »Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest! Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde« (Offb 3,15f.).
»Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder er wird den einen hassen und den andern lieben, oder er wird an dem einen hängen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.« Mt 6,24
Albert Camus: Das Leben als Sisyphosarbeit
Dass in diesem Zusammenhang die Entscheidung gegen den Gottesglauben nicht verächtlich und abwertend dargestellt werden darf, ist nicht nur von der christlichen Nächstenliebe, sondern auch von der Sache her geboten. Als Beispiel hierfür mag der französische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Albert Camus (1913–1960) dienen. 28
Camus vergleicht die menschliche Existenz mit dem Schicksal der griechischen Sagengestalt Sisyphos: Das Leben ist absurd.
»Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn’s hoch kommt, so sind’s achtzig Jahre, und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe.« Ps 90,10
Camus vergleicht in seinem Buch »Der Mythos von Sisyphos« die menschliche Existenz mit dem Schicksal der gleichnamigen griechischen Sagengestalt. Sisyphos, der die Götter durch sein rebellisches und ungehorsames Verhalten verärgert hat, ist dazu verdammt, in der Unterwelt einen Felsblock zum Gipfel eines Berges zu rollen. Immer, wenn er kurz vor dem Ziel ist, entgleitet ihm der Fels und rollt zurück in die Tiefe. Diesem aussichtslosen Vorgang entspricht nach Ansicht Camus’ die Absurdität des menschlichen Lebens. Es gibt für ihn – wie schon für Nietzsche – keinen Sinn im Leben, und es wäre auch unwürdig und feige, sich dies aus Angst vor den Konsequenzen nicht einzugestehen. Camus bezeichnet Sisyphos als einen beneidenswerten Menschen, und zwar deshalb, weil er sein Schicksal – insbesondere auf dem Rückweg zum Fuß des Berges – durchschaut und sich im vollen Bewusstsein der Absurdität der Situation, voller Trotz und voller Würde, wieder an die Arbeit macht: »Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.« 29Anders als Nietzsche sieht Camus die Auflehnung gegen die Sinnlosigkeit des Daseins auch nicht als einen Kampf der Starken gegen die Schwachen, sondern er betont in seinen Romanen angesichts des gemeinsamen Schicksals der Absurdität immer wieder die Werte der Solidarität und der Nächstenliebe. Oft ähneln Camus’ Gedankengänge dabei sehr stark Aussagen des christlichen Glaubens, doch Camus will bewusst ohne die Hypothese eines göttlichen Wesens auskommen, weil er will, dass der »Mensch in der Revolte« 30die volle und ungebrochene Verantwortung für sein Handeln übernimmt.
Der Mensch kann die Absurdität des Lebens erkennen und dagegen revoltieren. Das gibt seinem Leben Würde.
Die Revolte des Menschen trägt Züge der Solidarität und Nächstenliebe.
Das Beispiel Camus zeigt, dass auch Menschen, die nicht an Gott glauben, »gute« Menschen sein können.
Das Beispiel Camus zeigt also sehr gut, dass eine Leugnung Gottes und selbst die Annahme einer völligen Sinnlosigkeit der menschlichen Existenz nicht notwendig in Unmenschlichkeit, Unmoral und Barbarei enden müssen. Man kann die Wirklichkeit offensichtlich als absurd erleben und sich dennoch – oder vielleicht sogar deshalb – für Menschenwürde und Solidarität einsetzen. Diese Haltung verdient Respekt.
Rückfrage: Woher nimmt der Mensch die Kraft, um gegen die Absurdität des Lebens anzukämpfen?
Читать дальше