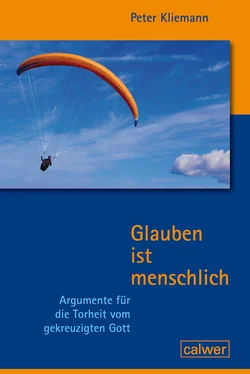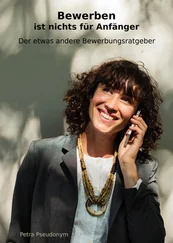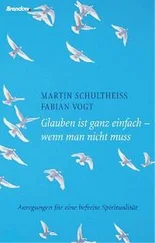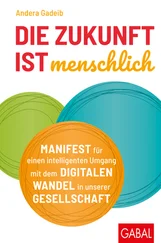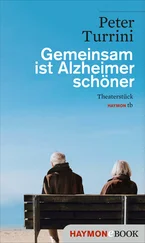1 ...7 8 9 11 12 13 ...18 »Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit.« 2. Kor 12,9
Allerdings wird der Christ auch fragen dürfen, woher der Mensch eigentlich die Kraft nimmt, sich gegen die Sinnlosigkeit des Lebens aufzulehnen, den Stein immer wieder zum Gipfel zu rollen, warum er eigentlich Solidarität und Nächstenliebe üben soll. Der christliche Glaube gibt hier Antworten, und er wird dem perspektivenlosen Bild vom immer wieder zurückrollenden Stein auch eine geschichtliche, zielgerichtete Sicht der Wirklichkeit entgegenhalten. Ob diese Sicht oder die Sicht Camus’ die richtige ist, lässt sich jedoch mit Vernunftgründen nicht entscheiden und beweisen.
Von welchem Gott ist eigentlich die Rede?
Der Begriff »Gott« ist nicht sehr aussagekräftig. Man muss sagen, von welchem Gott man spricht.
Wichtig ist bei der Diskussion der Gottesfrage schließlich, dass man sich immer wieder vor Augen hält, dass der Begriff »Gott« solange nicht sehr aussagekräftig ist, als man ihn nicht inhaltlich präzisiert, solange man also nicht sagt, von welchem Gott man redet. Sätze wie »Alle Menschen haben doch denselben Gott« gehen nur dem leicht von den Lippen, der sich nicht näher mit der großen Vielfalt der Religionen beschäftigt hat. Fernöstliche Vorstellungen von einem allen Erscheinungen zugrundeliegenden, unpersönlichen und unveränderlichen göttlichen Seinsgrund lassen sich z.B. nur schwer vereinbaren mit der jüdisch-christlichen Vorstellung eines persönlichen, sich in einer linear verlaufenden Geschichte offenbarenden Gottes. Jahwe ist nicht Baal oder Marduk, und der dreieinige Gott ist auch nicht Allah. In den folgenden Kapiteln werden deshalb die Konturen des spezifisch biblischen Gottesglaubens genauer zu umreißen sein. Vorher soll jedoch noch in einem eigenen Kapitel auf das Verhältnis von Glauben, Theologie und Naturwissenschaft eingegangen werden.
Kapitel III
Fängt der Glaube da an, wo das Wissen aufhört?
Zum Verhältnis von Glauben, Theologie und Naturwissenschaften
Der Glaube an Gott und die Naturwissenschaften – ein unüberwindlicher Gegensatz?
Viele Zeitgenossen sehen immer noch einen grundsätzlichen Gegensatz zwischen Gottesglauben und Naturwissenschaften. Wie ein Blick auf die Wissenschaftsgeschichte zeigt, beruht diese Annahme auf einem tragischen Missverständnis historischen Ausmaßes und ist deshalb nach Ansicht zahlreicher führender Naturwissenschaftler heute auch überholt: 31
Der scheinbare Gegensatz von Gottesglaube und Naturwissenschaft hat seinen Ursprung im 16. und 17. Jahrhundert: Dreht sich die Sonne um die Erde oder umgekehrt?
Entstanden ist der scheinbare Gegensatz zwischen Gottesglauben und Naturwissenschaft im 16. und 17. Jahrhundert, als die katholische Kirche meinte, die astronomischen Forschungen von Männern wie Kopernikus (1473–1543), Giordano Bruno (1548–1600) und Galileo Galilei (1564–1642) als Ketzerei zurückweisen zu müssen – ein absurder Vorgang nicht zuletzt deshalb, weil sich die genannten Wissenschaftler selbst als gläubige Christen verstanden. Der Vatikan sah in der These, die Erde sei nicht der Mittelpunkt des Planetensystems und das ganze Planetensystem vermutlich nur eines von unzählig vielen, nicht nur einen naturwissenschaftlichen Umbruch von ungeheurer Tragweite, sondern vor allem auch einen Angriff auf die Bibel, die kirchliche Lehrautorität und das von Gott gegebene Gesellschaftssystem. Wenn die Erde nicht mehr der Mittelpunkt des Weltalls war, wenn Gott nicht mehr jenseits der Fixsternsphären thronte, dann lag es allzu nahe, auch im Bereich der Kirche und der Gesellschaft die bisher als göttlich angesehenen Ordnungen und Werte in Zweifel zu ziehen und nach vernünftigen Begründungen zu verlangen. Hierbei ist zu bedenken, dass diese Befürchtungen der römischen Kurie angesichts der einschneidenden Veränderungen, die die Reformation Luthers, Zwinglis und Calvins mit sich gebracht hatte, nicht völlig aus der Luft gegriffen waren. Nicht zufällig konnte Kopernikus in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts noch unwidersprochen behaupten, was wenig später, als die Gegenreformation sich voll entfaltet hatte, Giordano Bruno auf den Scheiterhaufen und Galilei vor die Inquisitionsbehörden brachte.
»Damals redete Josua mit dem HERRN […], und er sprach in Gegenwart Israels: Sonne, steh still zu Gibeon, und Mond, im Tal Ajalon! Da stand die Sonne still, und der Mond blieb stehen […]« Jos 10,12f
Auch der Protestantismus weigerte sich lange Zeit, Erkenntnisse wissenschaftlicher Forschung zu akzeptieren. Der Gottesglaube geriet in den Verdacht der Wissenschaftsfeindlichkeit.
Doch auch der Protestantismus zeigte sich nicht immer für neue Gedanken offen. Insbesondere im Zeitalter der Aufklärung, als man anfing, die Bibel wie jedes andere Buch auf ihre historischen Entstehungsbedingungen hin zu untersuchen, betrachteten viele evangelische Theologen und Kirchenbeamte solche Fragestellungen als tabu und gerieten somit auf dem Gebiet der neu entstehenden Geisteswissenschaften in den Verdacht der Rückständigkeit. Der Fortschrittsoptimismus, die Entdeckerfreude und der Erfindergeist des 18. und 19. Jahrhunderts entwickelten sich in der Folge konsequenterweise in Opposition zu Theologie und Kirche, und bis heute existiert das kurzschlüssige Vorurteil, Glaube und Religion stünden prinzipiell im Widerspruch zu den Methoden freier und unvoreingenommener Wissenschaft.
Heute ergibt sich eine völlig neue Gesprächssituation:
Dass es sich hierbei um ein Vorurteil handelt, wird jedoch heute gerade auch von naturwissenschaftlicher Seite immer deutlicher erkannt:
Der Glaube an die Allmacht der Wissenschaft gerät ins Wanken. Insbesondere die ethischen Grenzen naturwissenschaftlicher Forschung werden deutlich.
»Wer sich auf seinen Verstand verlässt, ist ein Tor; wer aber in der Weisheit wandelt, wird entrinnen.« Spr 28,26
• Zum einen wurde der Glaube an Gott von zahlreichen Wissenschaftlern des 19. Jahrhunderts nur allzu offensichtlich durch einen anderen Glauben, nämlich den Glauben an den Fortschritt und die Erforschbarkeit der Welt ersetzt. Alles galt als erforschbar. Die Phänomene der Wirklichkeit, die man sich nicht erklären konnte, könne man sich eben noch nicht erklären. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis der Mensch, endlich von den Fesseln des Aberglaubens befreit, alle Probleme dieser Welt in den Griff bekommen würde. Diese Art von Scientismus (Wissenschaftsgläubigkeit), wie er in extremer Weise z.B. von dem Darwinschüler Ernst Haeckel (1834–1919) vertreten wurde, ist angesichts von Hiroshima und Nagasaki, angesichts von Umweltkatastrophen, unheilbaren Krankheiten oder den mit der modernen Genetik verbundenen Gefahren heute zumindest fragwürdig geworden. Naturwissenschaft kann vieles leisten. Sie kann die Zusammenhänge der Welt erklären und Erfindungen machen, über die wir nur staunen können. Doch ethische Probleme, die Frage, wie und mit welchem Ziel die Forschungsergebnisse und Erfindungen genutzt werden sollen, oder die Frage, ob es vielleicht Bereiche gibt, in denen der Mensch nicht einfach weiterforschen sollte, kann die Naturwissenschaft aus sich selbst heraus nicht beantworten. Versucht sie es dennoch, wird sie selbst zu einer unreflektierten Pseudoreligion, die dazu verurteilt ist, alle Umwege und Irrwege der bisherigen Religionsgeschichte noch einmal zu gehen, und zwar mit all den schwer kalkulierbaren Risiken, die der naturwissenschaftliche Fortschritt heute in sich birgt.
Die Untersuchungen der Atomphysiker Niels Bohr und Werner Heisenberg stellen das herkömmliche Wirklichkeitsverständnis grundsätzlich in Frage.
Читать дальше