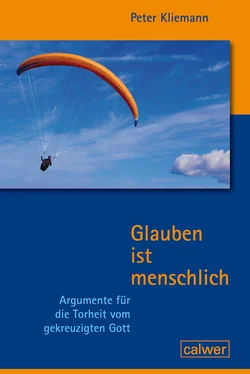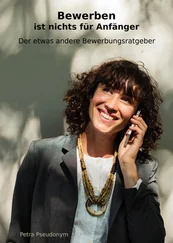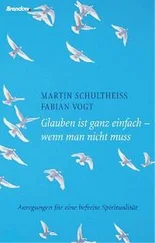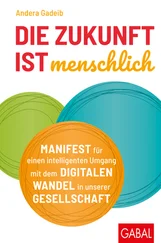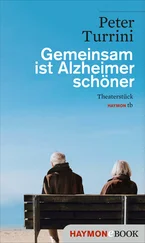1 ...8 9 10 12 13 14 ...18 • Zum anderen führten aber vor knapp 100 Jahren die Untersuchungen der Atomphysiker Niels Bohr (1885–1962) und Werner Heisenberg (1901–1976) zu einer erkenntnistheoretischen Grundlagenkrise der modernen Naturwissenschaften. Bohr entdeckte bei der physikalischen Untersuchung des Lichts, dass Licht je nach Versuchsbedingungen einmal als Strom von Teilchen, dann aber wieder als elektromagnetische Welle erscheint. Diese beiden Ergebnisse sind nach den Grundsätzen der klassischen Physik nicht miteinander vereinbar, und doch kann man das Phänomen des Lichts nur unter Zuhilfenahme beider Sichtweisen physikalisch angemessen erklären. Bohr bezeichnete diese Erscheinung von einander widersprechenden, sich aber ergänzenden Beobachtungen als »Komplementarität«. Heisenberg ist der Entdecker der sogenannten »Unschärferelation«, die besagt, dass sich Ort und Geschwindigkeit eines Elementarteilchens nie gleichzeitig genau bestimmen lassen. Misst man den Ort eines Elektrons, dann ändert sich unter Einwirkung der Messinstrumente bereits die Geschwindigkeit, und umgekehrt.
»Auch den Heiligen des Herrn ist es nicht gegeben, all die Wunder zu erzählen, die der Herr, der Allmächtige, geschaffen hat, damit das All durch seine Herrlichkeit Bestand hat. […] Wie wunderbar sind alle seine Werke, obwohl man kaum einen Funken davon erkennen kann!« Sir 42,17.22(23 )
Was aus diesen Untersuchungen Bohrs und Heisenbergs deutlich wird, ist, dass es für die moderne Naturwissenschaft nicht mehr möglich ist, wie im 19. Jahrhundert naiv von der Wirklichkeit und den sie unveränderlich bestimmenden Naturgesetzen zu sprechen. Die Wirklichkeit »an sich« gibt es nicht, immer nur Wirklichkeit, die ein erkennendes Subjekt unter einer bestimmten Fragestellung beschreibt. Das Subjekt gestaltet also durch seine Perspektive, sein Erkenntnisinteresse, seine Beschreibungssprache und die Anordnung der Versuchsbedingungen die Wirklichkeit mit. Wirklichkeit erscheint nicht mehr als eine subjektunabhängige, streng kausal strukturierte und somit genau berechenbare Welt von Objekten, sondern eher als ein Wechselspiel von Subjekt und Objekt, das zwar – ähnlich wie beim Schachspiel – nach bestimmten feststehenden Regeln verläuft, grundsätzlich aber nahezu unendlich viele Spielzüge gestattet und deshalb auch im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen nicht eindeutig prognostizierbar ist.
Es gibt mehr als einen Zugang zur Wirklichkeit.
»Habt ihr Augen und seht nicht und habt Ohren und hört nicht?« Mk 8,18
Wenn jedoch schon unter Naturwissenschaftlern nicht mehr naiv von der Wirklichkeit gesprochen werden kann, dann lässt es sich auch leichter akzeptieren, dass die naturwissenschaftliche Beschreibung der Wirklichkeit nur einen möglichen Zugang zur Wirklichkeit darstellt. Ich kann eine Blume biologisch als Stoffwechselsystem beschreiben, ich kann sie aber auch malen oder ein Gedicht über sie schreiben, sie als Futtermittel für Tiere betrachten oder: sie zum Anlass nehmen, über den Sinn des menschlichen Lebens oder die Frage nach Gott nachzudenken. Es ist nicht ausgemacht, welcher Zugang der »richtigere« ist, und die Blume wird auch stets »mehr« sein als die jeweilige Sichtweise, aus der heraus ich mich ihr gerade zuwende. Im Folgenden wird also näher zu bestimmen sein, welchen Zugang zur Wirklichkeit die Naturwissenschaften und welchen Zugang zur Wirklichkeit Glauben und Theologie wählen und was die jeweilige Fragestellung unter welchen Bedingungen leisten kann.
»Die Ros’ ist ohn’ warum, sie blühet, weil sie blühet, / sie acht’ nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie siehet.« Angelus Silesius (1624–1677)
Mythos und Logos
»Im Anfang war das Wort (lógos), und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. […] Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns […]« Joh 1,1.14
Die Erkenntnis, dass es unterschiedliche, sich deshalb aber nicht ausschließende Zugangsarten zur Wirklichkeit gibt, hat in der abendländischen Philosophiegeschichte eine lange Tradition. Seit der Antike wird immer wieder zwischen »Mythos« und »Logos« unterschieden. Beide Begriffe meinen im Griechischen zunächst »Rede, Wort«. Darüber, was die beiden Arten, von der Welt zu reden, unterscheidet und wie ihr Verhältnis zueinander genau zu bestimmen ist, wird unter Philosophen und Theologen bis heute gestritten. 32Sehr allgemein lässt sich sagen, dass »Logos« sich auf die rationale, vernünftige, begrifflich klar definierte Weise der Verarbeitung von Wirklichkeit bezieht, »Mythos« hingegen den eher erzählerischen, oft von Bildern und Symbolen geprägten Zugang zur Wirklichkeit meint. Dass der Mythos dabei nicht einfach durch den Logos »entmythologisiert« werden kann, dass der Logos nicht einfach »wahrer« ist als der Mythos, weiß jeder, der sich einmal intensiver auf Literatur und Kunst eingelassen hat, der sich vergeblich bemühte, seine Emotionen unter die Kontrolle der Vernunft zu bekommen oder der im Schlaf die Faszination und auch die Schrecken von Traumbildern erfahren hat.
7 Tage oder 18 Milliarden Jahre? Wie entstand die Welt?
Steht der biblische Schöpfungsglaube im Widerspruch zu naturwissenschaftlichen Erkenntnissen?
Wie wichtig es ist, sich der jeweiligen Fragestellung und ihrer Grenzen bewusst zu sein, belegt die insbesondere in den USA diskutierte Scheinalternative von biblischem Schöpfungsglauben und naturwissenschaftlichen Weltenstehungs- und Evolutionstheorien. Heutige Naturwissenschaftler halten es aufgrund der zu beobachtenden kontinuierlichen Ausdehnung unseres Weltalls für wahrscheinlich, dass dieses vor etwa 18 Milliarden Jahren durch den sogenannten »Urknall«, d.h. eine gewaltige Gasexplosion, entstanden sein könnte. Die ersten einfachen Lebewesen wie Amöben oder Pantoffeltierchen sind nach Ansicht von Biologen vermutlich vor rund drei Milliarden Jahren aufgetreten. Menschenaffen und Menschen gibt es hingegen erst seit einigen Millionen Jahren. So vorsichtig derartige Theorien von Naturwissenschaftlern heute auch formuliert werden mögen – stehen sie nicht in jedem Fall in einem völligen Widerspruch zu der Behauptung der Bibel, die Welt sei von Gott in nur sieben Tagen geschaffen worden, der Mann sei von Gott aus Erde geformt, die Frau später aus der Rippe des Mannes gebildet worden?
Schon das Alte Testament kennt zwei Schöpfungstexte, die in nicht unwesentlichen Punkten voneinander abweichen.
Wer so fragt, verkennt völlig die Aussageabsicht der biblischen Texte. 33Bei genauerer Betrachtung zeigt sich nämlich, dass wir es eigentlich gar nicht mit nur einem biblischen Schöpfungstext, sondern mit deren zwei zu tun haben. Zu unterscheiden ist der priesterschriftliche Schöpfungstext, der Gott immer als »Elohim« (in der deutschen Übersetzung: »Gott«) bezeichnet (1. Mose 1,1–2,4a), und der sogenannte jahwistische Schöpfungstext (1. Mose 2,4b–25), in dem stets der Gottesname »Jahwe« (in der deutschen Übersetzung: »der HERR«) benutzt wird. 34Diese zwei Texte weichen in nicht unwesentlichen Punkten voneinander ab. Um nur einige Beispiele zu nennen:
Während im ersten Text der Mensch nach den Tieren erschaffen wird, ist die Reihenfolge im zweiten umgekehrt. Während im ersten Text Mann und Frau gleichzeitig erschaffen werden, wird die Frau im zweiten Text erst nach und aus dem Mann erschaffen. Während Gott im ersten Text allein durch sein Wort ohne Inanspruchnahme irgendeines Materials schafft, formt er im zweiten den Mann aus Erde. Während der erste Text von sieben Schöpfungstagen ausgeht, kennt der zweite diese Einteilung nicht.
Die biblischen Schöpfungstexte wollen keine naturwissenschaftlichen Theorien über die Entstehung der Welt und der Lebewesen bieten.
Hätten diese beiden Texte den Anspruch, eine naturwissenschaftliche Theorie über die Entstehung der Welt und der Lebewesen zu bieten, so könnte man sich nur wundern, warum der Redaktor des 1. Mosebuches, der die beiden Texte vermutlich um 400 v. Chr. so aufeinander folgen lässt, wie sie uns heute vorliegen, nicht versucht hat, wenigstens die offensichtlichsten Spannungen und Widersprüche auszugleichen (von noch ganz anderen biblischen Vorstellungen über die Entstehung der Welt, etwa vom auch sonst im Alten Orient oft berichteten Kampf Gottes mit einem Meeresdrachen, ganz zu schweigen: vgl. z.B. Ps 74,13f.; Ps 89,10f.; Jes 51,9; Hiob 40,25ff.). Offensichtlich ist die Absicht der Texte jedoch eine ganz andere.
Читать дальше