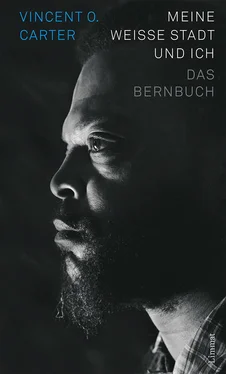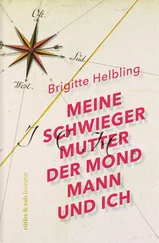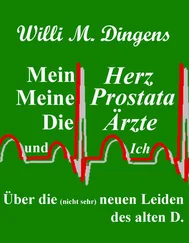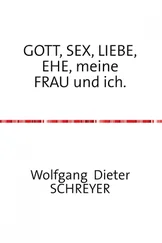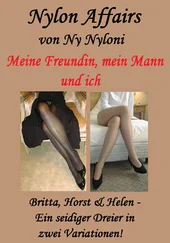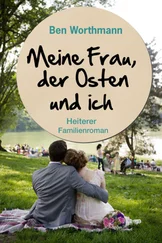So saß ich auf dem verregneten, düsteren Boulevard Saint-Michel und sah dem endlosen Strom von französisch sprechenden Menschen zu, die sich für nichts anderes interessierten, als dem trägen Impuls zu folgen, der sie die Straße auf und ab trieb. Die Aussicht, das Land von Rembrandt, Spinoza und Descartes zu besuchen, erschien mir mehr als rosig. Und während ich sie beobachtete, dachte ich, dass ich Montaigne, Rabelais und Villon deshalb so leidenschaftlich verehrte, weil die Franzosen eine so wichtige Rolle in meinem Leben gespielt hatten. Trotzdem kam es mir seltsam vor, dass ich die moderne französische Malerei, die Musik und Poesie so inständig lieben konnte. Baudelaire und Rimbaud waren meine engsten Freunde. Ich hätte den letzten Franc für einen Film von Jouvet ausgegeben! Warum konnte ich all das fühlen und die Menschen trotzdem so unsympathisch finden? Irgendetwas stimmte grundsätzlich nicht, doch damit kam ich damals einfach nicht zurecht …
‹Wenn Amsterdam so schön und das Leben so billig ist, wenn ihr beide Holländer seid und hier Probleme habt, warum lebt ihr dann nicht in Amsterdam?›, fragte ich ihn mit der Logik eines Pferdehändlers aus Missouri.
‹Meine Frau ist Jüdin›, entgegnete er. Ein hübsches Lächeln flog über ihr Gesicht. ‹Meine Eltern waren dagegen, dass wir heiraten …›
‹Um es milde auszudrücken!›, sagte sie und warf das dichte schwarze Haar über die Schulter.
‹Wir haben Amsterdam verlassen, um unser eigenes Leben leben zu können›, erklärte er. ‹Weil ein Schriftsteller vor allem frei sein muss, um so handeln und denken zu können, wie er will.›
‹Ich glaube, da hast du recht›, gab ich zurück. Seine Begleiterin stimmte mir mit einem spöttischen Lächeln zu. ‹Euer Mut hat mich zutiefst berührt, und obendrein habt ihr mir eine Lösung für mein eigenes Problem gezeigt.›
Kurz danach verabschiedete ich mich. Am nächsten Morgen fuhr ich nach Amsterdam. Ich weiß nicht mehr, um wie viel Uhr, aber es war der erste Zug, den ich nehmen konnte.»
Ein Kapitel, das dem Leser die Unvoreingenommenheit des Autors vermitteln soll
Das Gelächter und das anmaßende Grinsen meiner Freunde hatten dieses Kapitel notwendig gemacht. Ein oder zwei von ihnen kannten Paris sehr gut und hatten eine ganz andere Meinung von der Stadt und ihren Bewohnern. Ich musste gestehen, dass ich kaum Zeit gehabt hatte, mir ein wirklich objektives Bild von der Stadt zu machen, und meine Erfahrungen hauptsächlich die eines typischen Touristen gewesen waren.
«Hättest du dich in New York oder London nicht genauso einsam gefühlt?», fragte ein junger Mann, der bislang geschwiegen hatte.
«Ja, ganz bestimmt!», sagte ich. «Ich weiß es, denn ich habe diese Städte mehrmals besucht. Mir ist auch bewusst, dass Verallgemeinerungen gefährlich sind. Niemand reagiert auf diese Gefahr empfindlicher als ich. Es ist das Klischee unserer Zeit, dass wir in einem ‹verallgemeinernden Zeitalter› leben und vor der ‹gewaltigen Aufgabe› stehen, ‹überwältigende Mengen› von Informationen aus vielen verschiedenen ‹Bereichen› menschlicher Erfahrung auszuwerten: Aber es ist trotzdem wahr, insbesondere in meinem eigenen Land», räumte ich ein. «Ein Land, das fast ausschließlich aus dünnhäutigen Minderheiten besteht, die stereotypen Meinungen so ablehnend gegenüberstehen, dass die harmloseste Verallgemeinerung qualifiziert werden muss, wenn man sie nicht kränken will.
Wenn wir über Ideen diskutieren, ist eine der häufigsten Qualifizierungen, die Studenten dazu vorbringen – die ernsthaften ebenso wie die Stümper –, dass diese oder jene ‹Fakten› sich relativ zu diesen oder jenen Zusammenhängen verhalten. Dabei vergessen oder übersehen sie oft das eigentliche Problem, das einem eine solche Qualifizierung aufzwingt: Selbst wenn diese ‹Fakten› einen bestimmten Zusammenhang tatsächlich ‹relativieren› können – und es mit Sicherheit auch tun –, wird damit eine Referenz impliziert, zu der sich nichts ‹relativ› verhält. Hier liegt das eigentliche Problem. Wir vergessen, dass die Spezifizierung der Erfahrung lediglich ein bequemer Kunstgriff ist, der uns vom Intellekt auferlegt wird. Er hat nämlich seine potenzielle Entfaltung noch lange nicht erreicht, und wenn es ‹relative› Teile gibt, muss es mit Sicherheit auch ein ‹Ganzes› geben, selbst wenn wir es empirisch nicht beweisen können. Du hast völlig recht, wenn du mich darauf hinweist. Aber ich kann mich rechtfertigen, indem ich euch ein wirklich schönes, aber auch trauriges Erlebnis erzähle, das ich eines Abends mit einem jungen Pariser Soldaten in einem Bistro in der rue Monsieur le Prince hatte.
Ich hatte gerade für meinen Pernod bezahlt, und da ich das Gefühl hatte, dass die Rechnung wieder einmal zu hoch gewesen war, bat ich die Kellnerin um die Preisliste. Sie tat so, als hätte sie mich nicht verstanden, daher gab ich auf und ging. Ein junger Franzose in Uniform folgte mir auf die Straße und sagte: ‹Monsieur, vous avez trop payé pour votre verre!› Ich stimmte ihm entschieden zu und erklärte in meinem ärmlichen Französisch:
‹Das tue ich schon, seit ich in Ihre verfluchte Stadt gekommen bin, Sir. Franzosen sind Diebe und Halsabschneider, und man sollte sie alle dafür hängen!›
‹Mais non!›, rief er. ‹Es sind nicht alle Franzosen so. Sie kennen die Franzosen nicht, Monsieur. Nicht die in den Bars und den teuren Restaurants, sondern die wahren Franzosen.›
‹Da stimme ich Ihnen zu›, gab ich zurück. ‹Ich tue mein Bestes, um Touristenfallen zu meiden, aber ich weiß nicht wie, weil ich die Sprache nicht besonders gut beherrsche und nicht weiß, wo ich diese wahren Franzosen finden soll. Ich habe sogar Mühe, mich den schrecklichen Wesen verständlich zu machen, denen ich ausgeliefert bin!›
‹Kommen Sie mit!›
‹Wohin?›, fragte ich und musterte ihn etwas aufmerksamer. Nicht umsonst hatte Paris einen gewissen Ruf! Er wirkte harmlos, aber trotzdem … ‹Wo bringen Sie mich hin?›, fragte ich. Ich hatte Angst, er würde mir etwas andrehen wollen oder sei ein Zuhälter.
‹Zu meiner Frau. Sie trinkt gleich um die Ecke eine Limonade.›
Ich blieb stehen und sah mir den Kerl genau an. Er war viel größer als ich, aber sehr dünn. Er trug eine abgewetzte, doch relativ saubere französische Militäruniform. Der rechte Arm steckte in einer schwarzen Armbinde, die um seinen Hals hing, die rechte Hand hatte er in die Jacke gesteckt, als wäre der Arm gebrochen. Als er meinen misstrauischen Blick bemerkte, sagte er hastig: ‹Oh, Sie müssen keine Angst haben, Monsieur! Ich bin Korporal Henri Pitit.› Mit der linken Hand kramte er nach seinem Ausweis, um es mir zu beweisen. ‹Ich bin vor Kurzem vom Feldzug in Tunesien zurückgekehrt. Dort wurde ich verwundet.› Er zeigte mit der linken Hand auf den rechten Arm. ‹Ich wurde erst vor zwei Tagen aus dem Krankenhaus entlassen, deshalb bin ich so schwach und blass. Ich bringe Sie zu meiner Frau, die ich von ihrem Seminar an der Universität abhole. Sie studiert Medizin.› Er lächelte stolz. ‹Ich möchte Sie zu mir nach Hause einladen, damit Sie sehen, dass wahre Franzosen nicht wie diese Leute da sind. Dann werden Sie sehen, Monsieur, nicht alle Franzosen sind materialistische Parasiten.›
Ich versuchte einzuwenden, dass ich keinen Hunger hatte, weil ich gerade erst gegessen hätte, aber er wollte nichts davon wissen. Ehrlich gesagt, der Anstand des Mannes beeindruckte mich.
Wen interessiert es schon, was ich von den Franzosen halte, dachte ich bei mir. Doch ihm schien es offensichtlich sehr wichtig zu sein. Deshalb beschloss ich, mit ihm zu gehen.
Seine Frau war ein blasses, halb verhungertes, schmales Ding mit strähnigem dunkelbraunem Haar und klaren und mutigen Augen. ‹Guten Abend›, sagte sie, nachdem ihr Mann uns miteinander bekannt gemacht hatte. Und als er ihr sagte, dass er mich zum Abendessen eingeladen hatte, war sie auf ihre freundliche Art sofort einverstanden. In diesem Augenblick sah sie erst mich und dann ihren Mann mitfühlend an. Ich kam mir vor wie ein Idiot. Sie zahlte ihre Limonade, und wir verließen das Bistro. Mit der Metro fuhren wir zu einem Viertel, in dem ich noch nie gewesen war. An einer trostlosen Straße stiegen wir aus und liefen durch eine Gasse nach der anderen. Ich dachte an die Slums, in denen ich zur Welt gekommen war, und auch an die von London und Glasgow. Schließlich traten wir durch einen dunklen Toreingang in einen Korridor, der in einen Hof führte, und von da durch eine Tür in einen weiteren Korridor. Eine trübe gelbe Glühbirne an der Decke erhellte das schäbige Treppenhaus; es stank nach Urin und verschimmeltem Essen. Am Ende des Gangs befand sich ein Müllhaufen. Ratten nagten an leeren Konservendosen, und Kakerlaken krochen durch den feuchten Inhalt der überquellenden Mülltonne.
Читать дальше