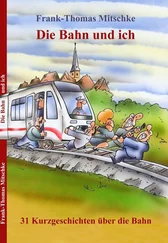Thomas Bachmeier
Meine Schwester Julia und ich
Eine Kurzgeschichte über ein inzestuöses Verhältnis
Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis
Titel Thomas Bachmeier Meine Schwester Julia und ich Eine Kurzgeschichte über ein inzestuöses Verhältnis Dieses ebook wurde erstellt bei
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Impressum neobooks
Meine Schwester Julia und ich
Eine Kurzgeschichte über ein inzestuöses Verhältnis
Thomas Bachmeier

Impressum
Texte: © Copyright by Thomas Bachmeier
Umschlag: © Copyright by Thomas Bachmeier
Verlag: Thomas Bachmeier
Tassilostraße 29a
85126 Münchsmünster
wgabauer@outlook.de
Druck: epubli, ein Service der
neopubli GmbH, Berlin
Printed in Germany
Am Freitag war mein letzter Arbeitstag vor meinem Urlaub. Ich wollte ihn daheim bei meinen Eltern verbringen. Irgendwohin zu fahren war mir lästig, zumal ich keine Frau oder Kinder hatte, die ich mitnehmen konnte. Ich rief bei meiner Mutter an, um ihr Bescheid zu geben.
„Hast du etwas von Julia gehört?“, fragte sie weinend.
„Nein, habe ich nicht“, antwortete ich.
Julia war meine Schwester.
Sie war vier Jahre jünger als ich. Sie war schon ein paar Jahre mit Peter verheiratet und hatte drei Kinder. Schon lange habe weder ich noch meine Eltern etwas von ihr gehört. Sie war verschollen. Jeder Versuch, sie anzurufen ging ins Leere. Zuerst war es nur so, dass ständig ihre Mailbox an war. Später dann gab es keinen Teilnehmer unter der Rufnummer mehr. Julia war und blieb verschwunden. Auch von Peter war nichts mehr zu hören oder zu sehen. Sie hatten sich offenbar in Luft aufgelöst.
Eine fünfköpfige Familie. Einfach so weg. Ich versprach meiner Mutter, dass ich nach ihr suchen werde. Versuchen konnte ich es ja. Fragt sich nur wo. Die Stadt war groß, viel zu groß, als dass man jemanden finden konnte, der nicht gefunden werden will. Für den Abend hatte ich mir vorgenommen, auswärts essen zu gehen. Ich wollte in ein Lokal, in dem ich schon öfter war.
Die Wirtsleute kannten mich. Sie waren beinahe schon so etwas wie Freunde geworden. Das Essen war hervorragend und reichlich. Da ich nicht gerade klein bin, benötige ich schon etwas größere Portionen, um satt zu werden. Bei ihnen hatte ich damit kein Problem. Die Portionen waren ausreichend groß und ich stand nie vom Tisch auf, ohne satt geworden zu sein.
Auf dem Weg dorthin musste ich durch eine Straße. Eine bei uns berühmt-berüchtigte Straße.
Das Rotlichtviertel. Hier standen die Huren am Straßenrand und boten ihre Dienstleistungen an. Es war alles dabei. Blonde, Schwarze, Braunhaarige, Rothaarige und was weiß ich noch alles. Auch sämtliche Nationen waren darunter vertreten. Vermutlich Opfer von Menschenhändlern, die ihre Ware hier ausstellten und sie dazu zwangen, sich selbst feilzubieten.
Ich fuhr langsam durch die Straße, denn ich wollte sehen, ob sich auch ein paar Minderjährige darunter befanden. Hie und da sah ich eine, von der ich glaubte, dass sie sicher noch keine achtzehn Jahre alt war. Aber da konnte man nicht sicher sein. Die Mädchen hier trimmten sich so, dass sie jung aussahen.
Manche Männer mögen das. Sie wollen junge Mädchen, koste es was es wolle. Ich gehöre nicht dazu. Ich war nur neugierig. Ich war ein paar hundert Meter die Straße entlanggefahren, da sah ich sie. Das war doch … Nein, das konnte nicht sein. Das musste … Ich fuhr noch ein paar Meter, dann wendete ich. Ich musste das genauer sehen. Wieder fuhr ich langsam an ihr vorbei. Nun war ich sicher. Das war Julia. Das war meine Schwester Julia. Julia hier auf dem Straßenstrich?
Ich konnte oder wollte es nicht glauben. Sie hatte doch lange blonde Haare. Dieses Mädchen aber trug schwarze, gelockte Haare. Eine Verwechslung? Gefärbte Haare oder eine Perücke? Ich wendete wieder. Ich fuhr langsam an den Huren vorbei. Vor Julia blieb ich stehen. Ich ließ das Fenster herunter.
Prompt kam sie an den Wagen.
„Französisch einen Hunderter, mehr kostet zweihundert und ohne Gummi fünfhundert“, sagte sie, ohne mich anzuschauen.
„Steig ein“, befahl ich. Erst jetzt blickte sie in den Wagen. Ich sah trotz der Schminke in ihrem Gesicht, dass sie aschfahl wurde.
„David? Was machst du denn hier?“
„Ich will dich mitnehmen“, antwortete ich.
„Mich mitnehmen? Das geht nicht. Ich muss Geld verdienen.“
„Steig ein“, befahl ich.
„Nein, ich kann nicht“, erwiderte sie.
„Was kostet es?“, fragte ich.
„Hab ich doch gesagt. Einhundert französisch und …“
„Ich geb dir zweihundert. Aber steig ein.“
Sie sah sich gehetzt um. Dann stieg sie ein.
„Was willst du von mir?“, fragte sie, als ich losfuhr.
„Ich will dich mitnehmen. Am Freitag hab ich meinen letzten Arbeitstag, dann fahr ich heim zu unseren Eltern. Du kommst mit.“
„Das geht nicht. Ich muss …“
„Du musst gar nichts. Wo ist Peter und wo sind die Kinder?“ Sie antwortete nicht.
„Sag schon. Wo sind sie?“
„Ich kann darüber nicht reden.“
„Warum nicht?“
„Er bringt mich um.“
„Wer? Peter?“
„Nein, Charly.“
„Wer ist Charly?“
„Mein Chef, wenn du so willst.“
„Dein Chef? Du willst wohl sagen, dein Zuhälter?“
„Hmmm.“
„Ich glaube, du hast mir eine Menge zu erklären.“
„Ich erkläre gar nichts.“
„Wir holen jetzt deine Sachen und dann kommst du mit zu mir.“
„Aber das geht nicht.“
„Warum soll das nicht gehen?“
„Weil es eben nicht geht.“
„Wo wohnst du?“, fragte ich, ohne auf die Antwort einzugehen.
„Die Straße runter. Hausnummer siebzehn.“
Ich kannte die Adresse. Wie oft war ich da wohl schon als Polizeibeamter drin. Ein versifftes altes Haus. Da wohnten nur Huren. Ekelhaft die Hütte. Ich fuhr bis ans Haus Nummer siebzehn. Vor der Haustüre stand ein Mädchen. Vielleicht grade mal siebzehn oder so. Julia wollte nicht aussteigen. Also stieg ich aus, ging um den Wagen herum und zog sie heraus.
„Wo wollt ihr hin?“, fragte das Mädchen.
„Das geht dich gar nichts an“, fauchte Julia sie an.
„Ich wäre vorsichtig an deiner Stelle. Charly ist oben. Er verkauft grad ein paar von uns an Harry.“
Julia schwieg. Ich schob sie in den Hausflur. Hier war alles wie sonst auch. Es stank nach billigem Parfüm, Urin und Scheisse. Ich ließ Julia los. Sie ging voraus nach oben. Ich folgte ihr bis in die dritte Etage. Dort hatte sie offenbar ihr Zimmer. Sie zog einen Schlüsselbund aus der roten Handtasche und sperrte eine Türe auf. Ich betrat das Zimmer hinter ihr. In dem Zimmer sah es aus, als hätten fünf obdachlose Säufer gehaust. Überall Dreck, nur Dreck. Die Bettdecke, vormals grau oder blau, lag verschlissen auf dem Bett. Es stank auch hier wie draußen. Nur kamen noch kalter Zigarettenrauch und der Gestank nach abgestandenem Bier dazu.
„Wo sind deine Sachen?“, fragte ich sie.
„Ich hab nur die Tasche hier. Mehr hab ich nicht“, antwortete Julia und zeigte mir eine Plastikeinkaufstasche.
„Gut, dann nimm sie und komm mit.“
Als ich mich der Türe zuwandte, stand ein Mann darin. Er hatte eine Kippe im Mundwinkel und grinste mich an.
Читать дальше