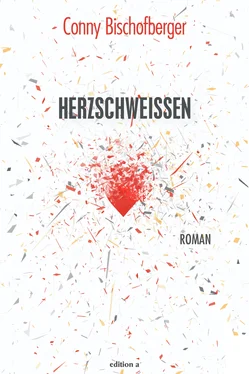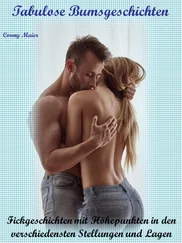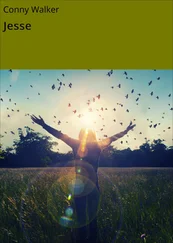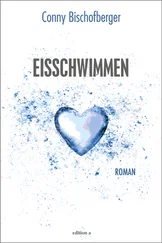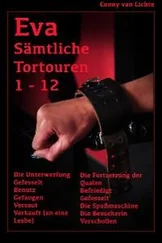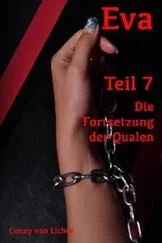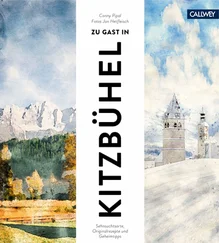Wäre sie kein Mädchen gewesen, sondern ein Bub, dann hätte sie wie ihre Brüder ins Gymnasium gehen können und später auf die Uni und außerdem einen BMW mit Sportfelgen fahren. So sollte sie den Kronenwirt des Nachbardorfes ehelichen und dann von ihrer Mutter, der singenden Sonnenwirtin, das durch Heirat vergrößerte Gastro-Imperium übernehmen. Das war fix geplant mit dem Kind, das zwar nicht geplant, aber sehr musikalisch war.
Bella musste noch heute schmunzeln, wenn sie daran dachte, denn der Kronenwirt war ein wirklich begehrenswerter Mann gewesen. Sie hatte sich für eine Nacht mit ihm entschieden, aber gegen den Rest.
Als Isabella die Tür zu ihrer Altstadtwohnung aufsperrte, bereitete Marcelo in der Küche gerade French Toast zu. Der Duft von gebräunter Butter, Eiern, knusprigem Weißbrot und frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer stieg ihr in die Nase. »Auch einen für dich?«, fragte Marcelo und schwenkte die Pfanne. Isabella nickte dankbar, legte ihre Magazine und Mappen auf dem großen Holztisch ab, warf den gelben Mantel über einen Stuhl und begrüßte ihre Tiger. Der kohlrabenschwarze Mogli schnurrte laut, die ungarische, getigerte Prinzessin strich ihr in Achtern um die Beine. Sie füllte die Katzenschüsseln, dann schenkte sie sich und ihrem spanischen Mitbewohner zwei Gläser kühlen Sancerre ein.
Aus dem CD-Player klang Haydns Paris-Symphonie Nummer 82, C-Dur. Der French Toast schmeckte wunderbar. Und in Gesellschaft von Marcelo noch besser. Mit jedem Jahrzehnt genoss sie es mehr, junge, aufgeschlossene Menschen um sich zu haben, sich inspirieren zu lassen von ihren Visionen und der Kraft, mit der sie diese Visionen vertraten. Isabella hatte schon mit Studenten aus Uruguay, Japan, Finnland, Holland, Italien, Spanien und Ungarn und einem Flüchtling aus Syrien gewohnt.
Sie fühlte Genugtuung darüber, dass sie sich damals ins Gymnasium gekämpft, schreiben gelernt und fortan selbst entschieden hatte, wie und wo und mit wem sie leben, für wen sie arbeiten und wofür sie ihre Kräfte einsetzen wollte.
Isabella wollte noch Mails checken, Nachrichten schauen, sich gedanklich auf den nächsten Interviewpartner für ihr Sonntagsformat einstimmen und ein heißes Bad mit Rosenöl nehmen. Das machte so schön müde. Und eine zarte, weiche Haut.
Frühstücksfernsehen, die Themen des Tages, der Studiogast, das alles gehörte zu Isabellas Morgen wie der selbst gemahlene African Blu, den sie mit Milch und eineinhalb Löffel Zucker aus der geblümten dänischen Tasse trank, dabei lag Mogli satt und müde auf ihrem Schoß.
Als Journalistin musst du Infos aufsaugen wie ein Schwamm, hatte Nana immer gesagt, und im richtigen Augenblick rufst du sie ab. Das ging beim Frühstücksfernsehen los und endete auf Twitter und Instagram, bevor sie ins Bett ging.
Isabella war durch eine harte Schule gegangen. Erste Ferialpraxis mit 17, dann startete sie als Redaktionsaspirantin eine zweijährige Ausbildungszeit bei der Lokalzeitung in Bregenz. An ihren ersten Auftrag erinnerte sie sich, als wäre er gestern gewesen: Sie musste über die Jahreshauptversammlung eines Bienenzuchtvereins berichten. Da war sie 18 und hatte gerade die Schule abgeschlossen. Schnell lernte sie, das Interessante im scheinbar Langweiligen zu finden. Es war alles eine Sache des Blickwinkels.
Mit dem ersten Gehalt kaufte sich Isabella einen gebrauchten, vanillegelben VW-Käfer, um unabhängig zu sein. Wenn der Polizeifunk – damals konnte man den noch heimlich abhören – einen schweren Unfall meldete, war sie schon unterwegs. Den Fahrersitz hatte sie mit einem weißen Lammfell überzogen.
Wie sie vor Jahrzehnten arbeitete, das konnten sich die jungen Kolleginnen und Kollegen gar nicht mehr vorstellen. Keine Handys, kein Internet! Die Grundausstattung waren Münzen, damit man in Telefonzellen jederzeit eine Geschichte durchgeben konnte, falls man keinen Fernschreiber fand. Faxgeräte mit Thermopapier waren die Steigerungsstufe der Technisierung. In den Journalisten-Hotels gingen regelmäßig die Thermopapierrollen aus. Und um in diesen Journalisten-Hotels zu wohnen, musste man jederzeit den richtigen Reisepass dabeihaben. Nummer eins für Israel und den Rest der Welt, Nummer zwei für arabische Länder.
Ihre Texte klopfte Isabella viele Jahre lang in die Schreibmaschine, Handgelenksentzündungen galten in den Siebzigern und Achtzigern als Berufskrankheit. Papier war kostbar, deshalb riss man die Blätter, wenn sie nicht ganz vollgeschrieben waren, ab und verwendete den Rest für eine Kurzmeldung. Mit »Rohrbomben«, das waren runde Plastikbehälter mit abschraubbarem Deckel, jagte man die Texte vom zweiten Stock der Redaktion durch einen Rohrschacht hinunter in die Druckerei. Dort kamen sie zum Bleisetzer, danach in Platten, die mit Spagat zusammengebunden waren. Die Titel passten manchmal nicht hinein, dann setzte der Druckereiarbeiter eine Schutzbrille auf, sägte die breitesten Buchstaben, wie »m« und »w«, an beiden Enden etwas ab, und es flogen Funken durch die Luft. Isabella liebte es, den Männern in den dunkelblauen Mänteln bei ihrer Arbeit zuzuschauen. Manchmal durfte sie auch ein »w« absägen.
Mit dem Aufkommen des Internets veränderte sich der Beruf von Grund auf. Nur eines veränderte sich nicht. Die Sprache war noch immer der Kern jeder Reportage, jedes Berichts, jedes Kommentars. Die Ehrfurcht vor der Sprache hatte Isabella nie verloren.
Es war 7.15 Uhr an diesem 29. November, in »Guten Morgen Österreich« ging es gerade um das Recht auf Nahrung und den Hunger in der Welt. Sie hörte, wie die Moderatorin den Studiogast ankündigte. Christoph Regner, neuer Geschäftsführer von »Amnesty International Österreich«. Aha, dachte sich Isabella, na ja, mal schauen, was der zu sagen hat.
Im Einspieler zur Story sah sie, wie Regner durch die Gänge der Amnesty-Zentrale schritt. Wie er seine Kappe abnahm, sich kurz über das grau melierte Haar strich, den schwarzen Mantel aufhängte, sein Blick hatte etwas Tragisches. In Westafrika bahne sich eine Hungerkrise an, die Zahl der unterernährten Menschen könne von 17 auf 50 Millionen steigen, hieß es im Bericht. Die Kamera fing ein, wie Regner mit seinem Team konferierte, an der Wand hingen Poster der neuen Amnesty-Kampagne, auf dem Tisch lagen Fotos von Slums in Nigeria. »Together we can beat poverty.«
Die Moderatorin begrüßte Regner im Studio. Großgewachsen, schlank, melancholischer Blick. Schwarze Jeans, weißes Hemd. Irgendetwas fesselte Isabella und sie schaute genauer hin. Für einen Moment dachte sie, eine Mundbewegung erhascht zu haben, als hätte Regner vor dem Auftritt noch rasch einen Apfel verspeist.
Dann hörte sie den Amnesty-Chef über die Arroganz des Westens reden, der schuld daran sei, dass noch immer alle fünf Sekunden ein Kind auf dieser Welt verhungerte. Seine Stimme klang wunderschön. Marx habe noch geglaubt, dass Hunger Schicksal sei, sagte Regner. »Aber hinter jedem Opfer steht ein Mörder. Das hier ist lautloser Völkermord.« Diese Sprachmelodie …
Während er von Enklaven des Glücks sprach und von einer Welt der Schmerzen, sah sie seine feingliedrigen Hände, die langen Finger, den Ring, und war im Innersten berührt. Wann er diese Welt der Schmerzen das erste Mal betreten habe, wollte die Moderatorin wissen. Regner sagte, das sei an einem Augustmorgen in Brüssel gewesen. Und erzählte die Geschichte zweier Jugendlicher aus Guinea, die im Fahrgestellkasten einer Boeing aus Afrika ihren Tod gefunden hatten. Er versprach sich kurz, lachte über sich selber, und fuhr fort. Isabella fand das sympathisch. Inhaltlich wurde es zunehmend schwieriger, ihm zu folgen, sie suchte seine Augen, die Brauen, die Fältchen, die Lippen, konnte sich nicht sattsehen. Einer der Jugendlichen habe einen Zettel in der Hemdtasche gehabt, auf dem stand: »Wenn ihr seht, dass wir uns geopfert haben, dann darum, weil wir in Afrika leiden und euch brauchen, um gegen die Armut zu kämpfen und dem Krieg ein Ende zu machen.« Seit diesem Erlebnis habe er sich geschworen, nie mehr auf der falschen Seite zu stehen.
Читать дальше