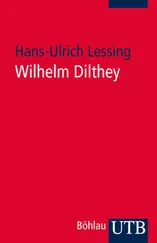Allerdings gibt es durchaus Autoren, die angesichts des Fehlens solcher formellen Einteilungshinweise hinter 3,1 in 3,1–24,53 einen in sich geschlossenen Hauptteil sehen. Freilich müssen auch sie dann diesen großen Abschnitt in Unterabschnitte zerlegen und sich dabei der genannten oder anderer Kriterien bedienen. Da die Wendung Jesu nach Jerusalem in 9,51 nicht nur deutlich angezeigt, sondern auch mit einer gewissen Feierlichkeit formuliert ist, wird dieser Einschnitt von vielen Autoren als Gliederungsmerkmal akzeptiert. Das gleiche gilt für 4,14 und 19,28/29, obwohl hierfür keine sprachliche Hervorhebung, sondern nur die Hinwendung nach Galiläa bzw. das erstmalige Betreten von Jerusalem und seiner Umgebung angeführt werden kann. Nicht umsonst sind die Autoren, die hier einen neuen Abschnitt beginnen lassen, uneinig, ob dieser mit 19,28 oder mit 19,29 beginnt. Außer der Annäherung an Jerusalem ist dort auch wirklich kein Signal für einen neuen Abschnitt zu entdecken. Dieses aber wird in 19,28 genannt, weswegen mit V. 28 der neue Abschnitt beginnen muss, wenn man hier einen Einschnitt finden will. Hat man sich so auf die Geographie als Gliederungskriterium einmal eingelassen, so kann man auch für den ersten Teil noch in 4,14 aufgrund der Hinwendung Jesu nach Galiläa einen weiteren Abschnitt beginnen lassen.
Legt man sich aber Rechenschaft darüber ab, nach welchem Kriterium diese Einteilung erfolgt ist, so ist dies außer dem konventionellen Einschnitt zwischen Vorwort und Korpus des Evangeliums in 1,5 und dem von Lukas deutlich auch sprachlich signalisierten Einschnitt in 3,1 f. nur die Geographie (4,14; 9,51; 19,28). Dann sollte man nicht auch noch mit 22,1, dem Beginn der Passionsgeschichte, einen neuen Abschnitt beginnen lassen. Das legt sich zwar vielleicht inhaltlich nahe, ist aber durch keine geographische Veränderung angezeigt – auf diese Art und Weise kann man ein einheitliches Gliederungskriterium einigermaßen durchhalten.
Diese Überlegungen führen zu folgender Einteilung:
| 1,1–4 |
Lukasprolog(Vorwort) mit Widmung an Theophilos |
|
|
| 1,5–4,13 |
Kindheitsgeschichten und Vorbereitung des Auftretens Jesu |
|
1,5–2,52 |
Die Kindheitsgeschichten Johannes des Täufers und Jesu |
|
3,1–4,13 |
Johannes der Täufer, Taufe und Erprobung Jesu |
| 4,14–9,50 |
Jesus in Galiläa und Judäa |
|
4,14–6,16 |
Beginn des öffentlichen Wirkens in Nazareth, Berufung der ersten Jünger, Heilungen und erste Auseinandersetzungen |
|
6,17–49 |
Die Feldrede |
|
7,1–9,50 |
Zyklus von Machttaten, Gleichnissen und zunehmende Auseinandersetzungen |
| 9,51–19,27 |
Der sog. „Reisebericht“ |
|
darunter: der barmherzige Samariter (10,25–37), Maria und Martha (10,38– 42), das Vaterunser (11,1–4), der reiche Kornbauer (12,13–21), das Gleichnis vom Gastmahl (14,15–24), der verlorene Sohn (15,11–32), das Kommen des Menschensohnes (17,20–37) |
| 19,28–24,53 |
Letzte Tage in Jerusalem, Tod und Auferstehung Jesu |
|
19,27–20,47 |
Einzug, Tempelaktion und Auseinandersetzungen mit Jerusalemer Gegnern |
|
|
21 Die Endzeitrede Jesu |
|
|
22–23 Passion, Tod und Begräbnis Jesu |
|
|
24 Die Auffindung des leeren Grabes, die Emmausgeschichte, die Ostererscheinung Jesu in Jerusalem und die Himmelfahrt Jesu |
2. Gründe für die Abfassung des Lukasevangeliums
Lk und Joh nennen Abfassungsgründe
Während Markus und Matthäus zu den Gründen, aus denen heraus sie sich zum Verfassen ihrer Schriften entschlossen haben, keine Auskunft geben, äußern Lukas und Johannes sich dazu. Beide geben deutlich zu erkennen, dass sie ein Buch für den Glauben schreiben wollen – dabei gibt es allerdings charakteristische Unterschiede. Während der Verfasser des Johannesevangeliums am Ende seines Werkes (20,30 f.) deutlich macht, dass es ihm wichtiger ist, den Nicht-Wunderstoff zu erzählen als noch mehr Wundergeschichten zu überliefern, dass aber gleichwohl die bereits erzählten Berichte von den „Zeichen“ besonders geeignet sind, zum Glauben zu führen bzw. in diesem zu halten, stellt Lukas in schriftstellerischer Manier seinem Werk ein Proömium / Vorwort voran, in dem er seine Absichten und sein Verfahren beschreibt. Ist hier auch im einzelnen manches umstritten und sind auch die Absichten, die Lukas mit seinem Evangelium und der Apostelgeschichte verbindet, in ihrer genauen Kennzeichnung kontrovers, so kann man doch sein Ziel anhand seiner Ausführungen wenigstens insoweit umschreiben, dass sein Werk wie das des vierten Evangelisten dem Glauben dienen, näherhin die Zuverlässigkeit der christlichen Lehre aufzeigen will. Wie es das im einzelnen anstrebt, ist allerdings nicht so eindeutig und auch Gegenstand heftiger theologischer Kontroversen geworden.
2.1 Glaube und Historie nach Lukas
Historische Glaubensbeweise
Die grundlegende Frage dabei ist, wodurch genau Lukas die Zuverlässigkeit, die er dem Theophilus mit Hilfe seines Werkes in Aussicht stellt, erreichen will und was diese Zuverlässigkeit der Worte, in denen Theophilus unterrichtet worden ist, exakt meint. Soll hier, wie vorgetragen worden ist, durch historische Rückfrage die Integrität der apostolischen Tradition sichergestellt und dem Glauben auf diese Weise ein zuverlässiges Fundament gegeben werden? Dagegen lässt sich natürlich trefflich einwenden, dass dann dem Glauben das menschliche Bemühen vorgeordnet werde und das Evangelium darüber hinaus unter das Lessingsche Verdikt von den zufälligen Geschichtswahrheiten falle. Zeigt aber Lukas in seinem Vorwort wirklich, dass er etwas ganz anderes will als seine Vorgänger, die sich mit dem Überliefern der Berichte der Tradition zufrieden gaben, während er zu den Tatsachen selbst durchstoßen will? Worin besteht z. B. der Unterschied zu Joh 20,30 f.? Dort ist doch auch nicht ganz allgemein und etwa im modernen Sinne an die Bedeutsamkeit der Wundergeschichten und die daraus zu ziehenden Konsequenzen gedacht, sondern die Wundergeschichten erzählen Dinge, die Jesus, noch zahlreicher als im Evangelium berichtet, „getan“ hat, und diese sind „aufgeschrieben, damit ihr glaubt“. Hier sind die Wunder kaum als zarter Hinweis gedacht, den man aufnehmen, aber auch ebenso gut überhören kann, sondern eher im Sinne des Ersten Vatikanischen Konzils als „ganz sichere Zeichen für die Göttlichkeit der Offenbarung“ verstanden. Lukas geht, das ist zuzugeben, den Weg der Tatsachen viel offener und auch breiter, indem er die Erkenntnis der Zuverlässigkeit der Lehre an seine gesamten Ausführungen und nicht nur an die Wundergeschichten bindet.
Das lukanische Werk als ganzes gewährt nach seiner Ansicht die Zuverlässigkeit der christlichen Lehre, weil sein Verfasser alles getan hat, was man von einem Historiker erwarten kann, allem sorgfältig und von Anfang an nachgegangen ist und es der Reihe nach aufgeschrieben hat. Daraus aber, dass der Bericht des Lukas „wahr“ im Sinne von historisch korrekt zu sein beansprucht, und aus der vorausgesetzten Übereinstimmung dieses Berichtes mit der Lehre, in der Theophilus unterrichtet worden ist, soll dieser deren Zuverlässigkeit erkennen. Vom Glauben ist direkt gar nicht die Rede, und dass die Übereinstimmung der beiden Zeugnisse die Wahrheit des von den Worten Gemeinten beinhaltet, ist ebenfalls auffälligerweise nicht gesagt. Nach Ausweis seines Vorwortes hat Lukas also als ein gebildeter ► Hellenist die evangelische Überlieferung einer sorgfältigen Überprüfung unterzogen und zweifelt keinen Moment daran, dass das Ergebnis seiner Untersuchung mit der Lehre, in der Theophilus unterrichtet ist, übereinstimmt. Dass er sich diese Mühe macht, spricht dafür, dass er sich davon etwas für den Glauben verspricht, aber wie er sich das Verhältnis zwischen der sich aus dieser Übereinstimmung ergebenden Zuverlässigkeit und dem Glauben denkt, gibt er nicht zu erkennen.
Читать дальше
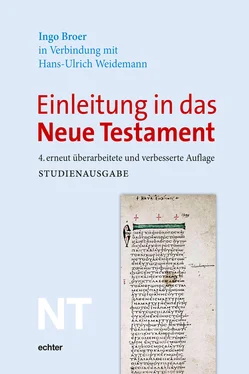
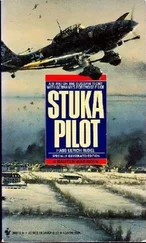


![Felix Sobotta - Das alte Jagdschloss und das neue Haus [Band 1]](/books/493473/felix-sobotta-das-alte-jagdschloss-und-das-neue-ha-thumb.webp)