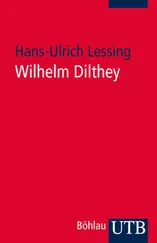Fragt man von daher nach der Bedeutung von Mt 8,11 f. und 21,43 für ein heutiges Kirchenverständnis und für die Frage nach dem Heil der Juden, so wird man unbeschadet der Tatsache, dass Matthäus die traurige Geschichte von Juden und Christen noch vor sich und nicht bereits hinter sich hat, darauf hinweisen müssen, dass 8,11 f. ein aus dem Ringen der Q-Gemeinde um Israel stammendes Drohwort ist und dass Mt 21,33–42 parMk das Verhältnis der Juden bzw. der jüdischen Obrigkeit zu Jesus mit Sicherheit aus nachösterlicher Sicht verzeichnet. Ob Matthäus dies freilich bei der Übernahme in sein Evangelium gesehen hat und beachtet wissen wollte, ist eine ganz andere Frage. Das Verhältnis des Matthäus zu Israel wird im Übrigen derzeit sehr breit diskutiert und z. T. positiver gesehen als in der Vergangenheit, bis dahin, dass der vollständige Übertritt zum Judentum incl. Beschneidung als angemessene Konsequenz des Bekenntnisses zu Christus angesehen wird (Sim) – ein Beispiel, das die Leserorientierung m. E. doch erheblich übertreibt.
Die Versuche, die in der Regel israel-kritisch gedeuteten Stellen des Matthäusevangeliums, z. B. 21,43 und 27,24 f., nicht israel-kritisch zu deuten, sind zwar aller Ehren wert, dürften aber den Tenor des ersten Evangeliums kaum treffen. Denn wenn es zum Beispiel in 21,43 nur um die Ablösung der jüdischen Autoritäten geht, an deren Stelle die Jünger treten sollen (Konradt), die die geforderten Früchte bringen, so fragt man sich unwillkürlich, warum Matthäus diese Aussage so kompliziert zum Ausdruck bringt und nicht statt vom Volk gleich von den Jüngern spricht. Die Deutung des „ganzen Volkes“ in Matthäus 27,25 auf Jerusalemer Volkshaufen wird zwar der historischen Perspektive durchaus gerecht, nicht aber dem besonderen Sprachgebrauch des Matthäus in 27,24f., der in seinem redaktionellen V. 25 nun einmal, statt die Bezeichnung „Volk“ aus V. 24 zu übernehmen, einen anderen, in der Septuaginta häufig für das Heilsvolk Israel gebrauchten Terminus verwendet. Dies gilt umso mehr, wenn es sich hier um einen „Schlüsseltext des Matthäusevangeliums“ handelt (Luz). Desweiteren ist auch auf den Fortgang des Evangeliums mit dem Missionsbefehl zu verweisen. Die Weisung der Jünger zu den Völkern durch den Auferstandenen im Unterschied zu dem nach Mt 15,24 ausschließlich zu Israel gesandten Jesus hat nach dem Duktus des Evangeliums in der Ablehnung der Botschaft Jesu durch „das ganze Volk“ in 27,25 seinen Grund.
Für das Verständnis des Verhältnisses von Israel und Kirche nach Matthäus ist wichtig, dass auch letztere unter dem Gericht steht. Die Glieder der Kirche haben nur eine Chance auf das Heil, wenn sie der Gottesherrschaft würdige Früchte bringen (21,43). Matthäus setzt das Heil in eine enge Beziehung zur Praxis (der Barmherzigkeit 9,13; 12,7). Matthäus verlagert die Gründung der Kirche in das Leben des historischen Jesus (16,18 f.), liefert die Begründung dafür aber mit seinem Gesamtwerk, das mit Jesu Tod und seiner Auferweckung endet. Der irdische Jesus wusste sich nach Matthäus ausdrücklich nur zu Israel gesandt (10,5bf.23; 15,24) und die Ablehnung Jesu durch Israel, die sich vor allem in der Szene vor Pilatus (27,24 f.) und in der trotz der eindeutig bezeugten Auferstehung erfolgten Verleumdung der Oberpriester und Ältesten (28,11–15) manifestiert, ist der Grund für die Gründung der Kirche und für die Hinwendung zu den Heiden. Deswegen kann erst der Auferstandene den Missionsbefehl zu den Heiden verkündigen. In der Situation von Mt 16,18 f. ist von den Heiden noch nicht die Rede.
Die Vollmacht der Kirche
Der Kirche ist die Befolgung der ihr von Jesus übergebenen Weisung aufgetragen, sie hat aber auch selbst die Vollmacht, den Willen Gottes zu interpretieren, was Matthäus faktisch am Ehescheidungsverbot demonstriert und theoretisch mit der Vollmacht zum Binden und Lösen in 16,19 und 18,18 verdeutlicht. Diese Vollmacht ist noch nicht an ein Amt gebunden, da Matthäus mit Ausnahme von christlichen Schriftgelehrten noch keine Ämter in der Kirche kennt. Im Gegenteil, in 23,8–12 betont er stark die Bruderschaft in der Gemeinde. Dementsprechend stellt er die Jünger auch nicht als Vorbild und ideale Christen dar, sondern lässt sie für die Christen seiner Zeit mit allen ihren Stärken und Schwächen transparent werden. Nicht umsonst nennt er sie mehrfach Kleingläubige und verweist so darauf, dass sie zwar schon den Glauben haben, dass dieser aber noch nicht die angemessene Tiefe besitzt.
Matthäus hat so aufgrund der schmerzvollen Trennung von der jüdischen Synagoge die Selbständigkeit der Kirche auf Kosten des Judentums stark hervorgehoben, eine besondere heilsgeschichtliche Rolle Israels ist für ihn nicht mehr gegeben. Allerdings ist die Kirche nicht einfach schon im Heil, sondern steht selbst noch unter dem Gericht, das aufgrund der Werke erfolgt. Welche Werke gefordert sind, hat der Jesus des Evangeliums kraft der ihm von Gott gegebenen Autorität festgelegt, aber auch die Gemeinde als Ganze partizipiert an dieser Vollmacht und hat die Aufgabe, den von Jesus interpretierten Willen Gottes je neu auf die konkrete geschichtliche Lage anzuwenden. Dabei rechnet Matthäus nicht mit fehlerfreien und sündlosen Menschen, sondern zeichnet bereits die Jünger in der Nachfolge Jesu als auf dem Weg, aber eben noch nicht am Ziel.
Das Evangelium des Matthäus spiegelt den Weg der nachösterlichen Gemeinde aus dem Judentum heraus zur beschneidungsfreien Heidenmission und legitimiert diese. Indem die Gemeinde diesen Weg geht, bleibt sie ihrem Herrn und seinen Weisungen treu. Matthäus bringt Jesus in ein so intensives Verhältnis zu Gott, dass er seine natürliche Herkunft auf den Heiligen Geist zurückführt. Deswegen kennt Jesus auch den Willen Gottes, was ihn aber von Problemen mit dem Willen Gottes nicht enthebt. Weitere Themen der matthäischen Theologie sind das Gesetz und die Kirche.
Literatur
1. Kommentare
DAVIES, W. D. / ALLISON, D. C., A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. Matthew I–III (ICC) Edinburgh 1991 ff.; FIEDLER, P., Das Matthäusevangelium (ThKNT 1) Stuttgart 2006; FRANKEMÖLLE, H., Matthäus-Kommentar 1/2, Düsseldorf 1994.1997; GNILKA, J., Das Matthäusevangelium 1 und 2 (HThK I/1 und 2) Freiburg u. a. 31993. 21992; HARE, D. R.A., Matthew, Louisville 1993; HARRINGTON, D. J., The Gospel of Matthew (Sacra Pagina 1) Collegeville 1991; KEENER, C. S., A Commentary on the Gospel of Matthew, Grand Rapids, Mich. / Cambridge 1999; KONRADT, M., Das Evangelium nach Matthäus (NTD 1) Göttingen 2015; LUCK, U., Das Evangelium nach Matthäus (ZBK. NT 1) Zürich 1993; LUZ, U., Das Evangelium nach Matthäus I–IV (EKK I/1 5–4) Zürich u. a. 1989 ff.; MAIER, G., Das Evangelium des Matthäus I, Holzgerlingen 2015; MORRIS, L., The Gospel acc. to Matthew, Grand Rapids, Mich. / Leicester 1992; MOUNCE, R. H., Matthew (NIBC) Peabody 1993; SAND, A., Das Evangelium nach Matthäus (RNT) Regensburg 1986; SCHNACKENBURG, R., Matthäusevangelium Bd. 1 und 2 (NEB 1/1 und 1/2) Würzburg 21991. 21994; SCHWEIZER, E., Das Evangelium nach Matthäus (NTD 2) Göttingen 41986; WEBER, S. K., Matthew (Holman NT Commentary 1) Nashville 2000; WIEFEL, W., Das Evangelium nach Matthäus (ThHK 1) Leipzig 1998.
2. Monographien und Aufsätze
BALCH, D. L. (Hg.), Social History of the Matthean Community. Cross-Disciplinary Approaches, Minneapolis 1991; Bauer, D. R. / Powell, M. A. (Hg.), Treasures New and Old. Recent Contributions to Matthean Studies (SBL Symp. Ser. 1) Atlanta, GA 1996; BORNKAMM, G. / BARTH, G. / HELD, G., Überlieferung und Auslegung im Matthäusevangelium (WMANT 1) Neukirchen 71975; BORNKAMM, G., Studien zum Matthäus-Evangelium (WMANT 125) Neukirchen-Vluyn 2009; BROER, I., Das Verhältnis von Judentum und Christentum im Matthäus-Evangelium (Franz-Delitzsch-Vorlesung 1994) Münster 1995; ders., Versuch zur Christologie des ersten Evangeliums, in: Segbroeck, F. v. / Tuckett, C. M. / Belle, G. v. / Verheyden, J. (Hg.) (s. § 4 unter Zeller) 1251–1282; CUVILLIER, E., Torah Observance and Radicalization in the First Gospel. Matthew and First-Century Judaism: A Contribution to the Debate, in: NTS 55 (2009) 144–159; DAVID, E. (Hg.), The Gospel of Matthew in current study. Studies in memory of W. G. Thompson, Grand Rapids, Mich. 2001; DEINES, R., Die Gerechtigkeit der Tora des Menschensohnes (WUNT 177) Tübingen 2004; ders., Das Erkennen von Gottes Handeln in der Geschichte bei Matthäus, in: Frey, J. (Hg.), Heil und Geschichte. Die Geschichtsbezogenheit des Heils und das Problem der Heilsgeschichte in der biblischen Tradition und in der theologischen Deutung (WUNT 248)
Читать дальше
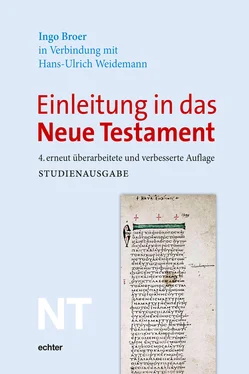
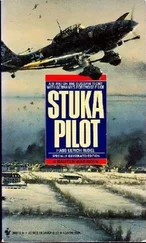


![Felix Sobotta - Das alte Jagdschloss und das neue Haus [Band 1]](/books/493473/felix-sobotta-das-alte-jagdschloss-und-das-neue-ha-thumb.webp)