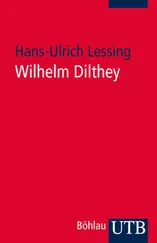Gesetz und Situation
Gleichwohl betrachten Matthäus und wohl auch seine Gemeinde diese Weisung ihres Herrn nicht als sakrosanktes, in seinem exakten Wortlaut stets zu bewahrendes göttliches Gesetz. Einem solchen Verständnis widerspricht die von allen urgemeindlichen Zentren geteilte Tendenz, die Worte Jesu nicht dem Wortlaut nach zu überliefern, sondern dem Sinne nach, und sie zugleich auf die die Gegenwart bedrängenden Fragen hin zu fokussieren. Bei Matthäus haben wir in den Eheweisungen ein schönes Beispiel dafür, dass er sich genauso verhalten hat. Denn Matthäus überliefert hier eindeutig nicht das ursprüngliche strenge Eheethos des historischen Jesus, wie er es bei Markus vorfand (Mk 10,6–10 parMt 19,4–9; vgl. auch Mt 5,32), sondern erlaubt eine Ausnahme vom absoluten Ehescheidungsverbot. Offensichtlich waren er und seine Gemeinde der Meinung, dass diese Ausnahme vom Eheethos des historischen Jesus durchaus gedeckt wird, und sie hielten eine Überlieferung des Sinnes für wichtiger als das sklavische Festhalten am Wortlaut. Den Maßstab für die Anpassung der Gesetzes-Vorschriften an die Gegenwart nennt Matthäus in seinem Evangelium häufig. Mit Markus nennt er das Liebesgebot zusammen mit dem der Gottesliebe als höchstes Gebot (22,35–40 par Mk), stärker als Markus stellt er das der Gottesverehrung dem der Nächstenliebe gleich (22,39) und betont beide als Summe und Angelpunkt des Gesetzes (22,40). Über Markus hinaus führt er (in 9,13 und 12,7 mit einem Zitat von Hos 6,6 „Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer“) die Barmherzigkeit als Maßstab ein, und schließlich lässt er die exakt gegliederte Reihe der Antithesen im Feindesliebesgebot gipfeln (5,43–48).
Gnade und Werke
Häufig wird in der Literatur die Frage gestellt, wie es denn im Matthäusevangelium mit dem Verhältnis von Gnade und Werken sei, gelegentlich wird sogar der Gedanke der zuvorkommenden Gnade der späteren kirchlichen Tradition bereits im Matthäusevangelium gefunden. Aber es begegnet auch das Verdikt, Matthäus lege Jesus immer wieder Worte von der Verdienstlichkeit der Werke in den Mund und insofern bestehe ein unüberbrückbarer Gegensatz zu Paulus und seiner Lehre von der Rechtfertigung allein aus Glauben, die als die Mitte der Schrift über die Zugehörigkeit zum Kanon zu entscheiden habe. Wenn der Verfasser des ersten Evangeliums auch später schreibt als Paulus, so sind ihm die Paulusbriefe doch nicht bekannt gewesen, zumindest wird deren Kenntnis in seinem Evangelium an keiner Stelle erkennbar, und man tut gut daran, sein Werk nicht mit Hilfe fremder Kategorien zu vermessen, wenn natürlich auch hinter der Frage ein ernsthaftes Anliegen steht. Dieses besteht nicht nur in der Frage nach dem Verhältnis zur paulinischen Theologie – nicht notwendig als Kanon im Kanon verstanden – und der Einheit der Schrift, sondern z. B. auch darin, ob Matthäus so etwas wie Gnade kennt. Dass bei Matthäus die Werke stark betont sind, kann nicht bezweifelt werden; man vergleiche nur 5,19; 7,15–27; 25,31–46. Aber auch Paulus fordert ja das Wirksamwerden des Glaubens in der Liebe (Gal 5,6) und spricht von der Erfüllung des Gesetzes (Röm 13,8–10) bzw. des Gesetzes Christi (Gal 6,2) – insofern kann nicht schon die Forderung nach Erfüllung des Gesetzes, zumal wenn die Liebe der Maßstab dafür ist (Mt 7,12; 22,39 f.), den Gegensatz zu Paulus konstituieren, sondern erst der Stellenwert dieser Werke. Erst wenn der Mensch nach Matthäus von sich aus in der Lage wäre, sich selbst durch gute Werke das Heil unabhängig vom Christusereignis zu beschaffen, wäre ein Gegensatz zu Paulus gegeben. Dass es Stellen im Evangelium gibt, die so verstanden werden können, kann nicht bestritten werden (vgl. Mt 25,31–46). Hier spielen der Glaube und das Christusereignis keine Rolle für das zuzusprechende Heil, außer dass der Menschensohn mit dem Richter identifiziert wird. Allerdings kennt auch Paulus eine Überordnung der Liebe über den Glauben (1 Kor 13,13) sowie das Gericht nach den Werken (Röm 2,13; 14,10; 1 Kor 4,5; 2 Kor 5,10), was noch einmal zu demonstrieren vermag, dass die Frage komplex angegangen werden muss und man sich nicht einfach auf einzelne Formulierungen stützen darf.
Liebe
Seligpreisungen
Es ist in diesem Zusammenhang auf die Seligpreisungen hinzuweisen, deren bloß ethisches Verständnis eindeutig ein Missverständnis der matthäischen Intention darstellt, da diese primär Zuspruchs- und erst sekundär auch Forderungscharakter tragen, ebenso auf die Sprüche vom Salz der Erde und Licht der Welt (5,13–16), wo dem Befehl zum Salzen und Leuchten die indikativische Aussage „Ihr seid …“ vorausgeht, und schließlich auf die Parabel vom Verzicht auf das Prinzip von Leistung und Gegenleistung (18,23–35), die in ihrer Aussagespitze gerade von dem Missverhältnis von empfangener Gabe und eigener Gebebereitschaft lebt, sowie auf die Parabel von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20,1–16). Auch Mt 26,28 ist hierfür ebenso in Rechnung zu stellen wie die Tatsache, dass Matthäus Judenchrist ist und die paulinische Sicht dem Judentum sicher nicht in jeder Hinsicht gerecht wird. Wenn also Matthäus auch den paulinischen Begriff für Gnade nicht kennt, so gibt es doch wenigstens eine Reihe von Ansatzpunkten für die Ansicht, dass Matthäus nicht einfach mit den judaistischen Gegnern des Paulus in einen Topf geworfen werden darf, wenn vielleicht auch die Aussage von 24,20 dafür spricht, dass die matthäische Gemeinde noch den Sabbat feiert.
Matthäus bejaht also das Gesetz, lässt es Jesus freilich eigenständig interpretieren. Der Maßstab für diese Interpretation ist das Liebesgebot, wobei die Anwendung des Liebesgebotes auf das jesuanische absolute Ehescheidungsverbot Matthäus zu etwas anderen Konsequenzen führt, als Jesus sie gezogen hat. Diese Einbindung des Gesetzes in die jesuanische Interpretation und eine Reihe von Einzelstellen sprechen dagegen, dass Matthäus das vertritt, was man in paulinischer Theologie mit „Werkerei“ bezeichnet.
7.4 Die Kirche
Nur zweimal „Kirche“
Dass das Thema Kirche für das Evangelium wichtig ist, kann man nicht unbedingt der Häufigkeit des Wortes entnehmen, das bei Matthäus nur zweimal begegnet – allerdings steigt das Gewicht dieser zwei Belege enorm, wenn man sich vor Augen hält, dass das Wort Kirche in den übrigen Evangelien überhaupt nicht begegnet. Darüber hinaus gehören zu diesem Wortfeld auch Begriffe wie das „Reich des Menschensohnes“ (16,28), so dass sich auch die Zahl der Belege noch erhöht. Schließlich ist das erste Evangelium das einzige im Neuen Testament, das eine Kirchenstiftung durch den historischen Jesus überliefert.
Situative Polemik
Das Thema Kirche als einer eigenständigen, von Israel unabhängigen Institution des Heils ist für Matthäus von besonderer Bedeutung, und diese Tatsache kann angesichts der dargestellten Situation seiner Gemeinde nicht verwundern. Diese Situation lässt aber zugleich auch erwarten, dass das Verhältnis von Israel und Kirche von Matthäus nicht neutral und objektiv, sondern polemisch und vielleicht auch karikierend beschrieben wird. Jedenfalls darf man sicher nicht z. B. 8,11 f. einfach im Sinne der Summe eines Traktats über Israel und die Kirche verstehen, sondern muss diesen Satz von der Auseinandersetzung zwischen Judentum und Kirche her deuten. Zwar handelt es sich dabei um ein Wort aus der Logienquelle, aber offensichtlich passt dieses auch noch in die Situation des Matthäus. Das gleiche gilt für 21,43 – dies sind nicht einfach Sätze, die im 20. Jahrhundert zur Basis der Beschreibung des Verhältnisses von Judentum und Christentum genommen werden dürfen, wenn freilich auch nicht einfach die furchtbaren Ereignisse des 20. Jahrhunderts – um nur diese zu nennen – den Maßstab für die Auslegung der Schriften aus dem ersten Jahrhundert abgeben dürfen. Am ehesten wird diesen Sätzen eine Deutung aus ihrer Entstehungssituation gerecht (womit noch einmal die Einleitungswissenschaft und ihre Fragen gerechtfertigt werden), die auch die Tatsache zu berücksichtigen hat, dass Matthäus in dieser Kontroverse rhetorische Figuren der jüdischen Polemik gebraucht. Diese stellen im Kontext des Evangeliums zwar eine Kritik Israels von außen dar, zum Zeitpunkt ihrer Entstehung aber dürften sie Teil einer innerjüdischen Auseinandersetzung gewesen sein, da keineswegs alle diese Äußerungen als von Matthäus selbst redaktionell in der Zeit nach der Trennung von der jüdischen Gemeinde verfasst angesehen werden dürfen. Aber auch Matthäus wird sich selbst als Judenchrist nach der Trennung noch solcher Redemuster bedient haben, ohne sich Rechenschaft darüber abzulegen, dass solche Rede in einem nicht-jüdischen Kontext zu Fehlschlüssen führen kann und muss. Freilich bleibt trotz dieser Abhängigkeit von den Mustern jüdischer Polemik die Frage bestehen, wie mit diesen polemischen Aussagen heute umzugehen ist. Denn polemische Aussagen eines Autors enthalten durchaus einen wahren Kern, der auch außerhalb der Polemik Gültigkeit besitzt – es sei denn, es handelt sich um Polemik um ihrer selbst willen. Insofern darf man es sich mit den antijüdischen Aussagen des Matthäus auch nicht zu leicht machen.
Читать дальше
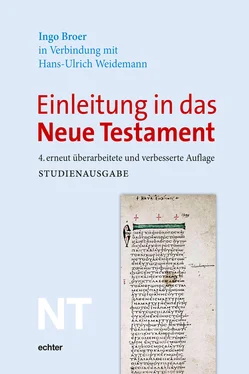
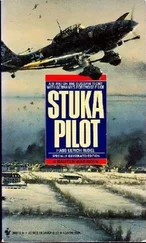


![Felix Sobotta - Das alte Jagdschloss und das neue Haus [Band 1]](/books/493473/felix-sobotta-das-alte-jagdschloss-und-das-neue-ha-thumb.webp)