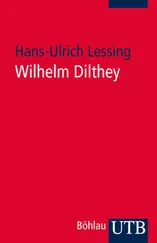Funktion der Schweigegebote
Die literarische Funktion dieser Konstruktion kommt in ihrem künstlichen, eher für schriftliche als für mündliche Literatur bezeichnenden Charakter zum Ausdruck: Die Verbreitung des Wunders wird verboten, aber das Wunder und das entsprechende Verbot werden erst einmal erzählt.
Grenze der Schweigegebote
Auf der Ebene des Markus ist dieser Widerspruch kein Problem, weil er in 9,9 Tod und Auferstehung Jesu als Grenze für das Schweigegebot bezeichnet hat – danach darf offen darüber gesprochen werden!
Wunder und Leiden
Nimmt man Mk 9,9 zusammen mit dem Bekenntnis des unbekannten Hauptmannes unter dem Kreuz, der ausgerechnet angesichts des Todes Jesu zu der Erkenntnis kommt, dass der soeben Verstorbene kein normaler Mensch, sondern ein Gottessohn war (Mk 15,39), und zieht dann auch noch mit in die Betrachtung ein, dass Markus gleich drei Leidensweissagungen in seinem Werk bietet (8,30–33;9,31;10,32–34), dann wird deutlich, dass Markus unbeschadet der Frage, welche Teile des ganzen Komplexes er schon in seiner Tradition vorfand und welche er selbst geschaffen hat, bewusst die Wundergeschichten und die Perikopen um die Hoheitstitel überliefert, dass er diese aber mit Hilfe des Schweigegebots mit dem Leiden Jesu zusammengebunden hat. Zu Jesus gehören die Wunder und das Leiden, weil er der Messias und der leidende Menschensohn zugleich ist.
Die Vermutung, die Gemeinde des Markus habe in der häretischen Gefahr gestanden, Jesus ausschließlich von der Wunder- und Hoheitsseite zu sehen, geht sicher viel zu weit, aber Markus hat nach Ausweis seines Werkes – vgl. vor allem die Abfolge von 8,27–30 und 31–33! – beide Seiten in Jesu Person zusammenbinden wollen.
Nach Markus ist der Jesus der Wunder nicht ohne das Leiden, und der Jesus des Leidens nicht ohne die Wunder zu haben. Beide Aussagereihen, Wunder und Kreuz, dürfen für ein im Sinne des Markus zutreffendes Verständnis von Person und Werk Jesu auf keinen Fall voneinander getrennt werden.
Das Schweigen der Frauen
Dass das Verbot, die Wunder weiter zu erzählen, nach dem Evangelium nicht gehalten wird, hat seinen Gegenpart in dem das Markusevangelium beendenden Schweigen der Frauen nach ihrer Flucht aus dem leeren Grab, hier nun gegen den ausdrücklichen Engelbefehl an sie, Petrus und die Jünger von der Auferweckung Jesu und von seinem Vorausgehen nach Galiläa zu unterrichten.
Wie dort entgegen dem Befehl Jesu das Wunder nicht verschwiegen, sondern öffentlich verkündigt wird, so vermag auch hier die menschliche Unzulänglichkeit der Frauen das Offenbarwerden der Auferstehung nicht zu verhindern. Die Botschaft von Jesus, von seinen Wundern und von seiner Auferstehung, setzt sich durch, auch gegen alle menschliche Unzulänglichkeit. Wie Jesu Wunder nicht verborgen bleiben konnten, so auch seine Auferstehung nicht. Obwohl die Frauen nichts erzählt haben, ist die Auffindung des leeren Grabes dennoch bekannt, und Markus kann sie erzählen.
Dass Markus mit 16,8 zum Ausdruck bringen wolle, die Jünger seien nie von der Auferstehung in Kenntnis gesetzt worden, und mit Hilfe dieser „Nachricht“ seinen Wunsch, „die Aufmerksamkeit vom Auferstandenen weg zum Gekreuzigten zu lenken“ (Kelber, Anfangsprozesse) verdeutliche, scheint mir weder der Erzählung Mk 16,1–8 noch dem Gesamtduktus des Evangeliums zu entsprechen. Dieser betont gerade nicht einseitig das Leiden, sondern auch die wunderbare Seite des Gottessohnes.
Das Leiden der Jünger Jesu
Der Notwendigkeit des Leidens Jesu geht die des Leidens der Jünger parallel, wie Markus z. B. im Nachtrag zur ersten Leidensverkündigung deutlich macht (8,34 ff.). Markus illustriert auf diese Weise, was Matthäus mit Hilfe eines Wortes der Logienquelle so sagt: „Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss sich damit begnügen, dass es ihm geht wie seinem Herrn.“ (Mt 10,24 f.)
Wie schwer die Akzeptanz dieser Notwendigkeit für die Jünger war und auch noch ist, zeigt Markus an der Reaktion des Petrus auf die erste Leidensansage und in Mk 10,35 ff.
11.1.2 Das Jüngerunverständnis
Das Jüngerunverständnis, das bei Markus mehrfach begegnet (4,10.13;6,52; 7,17 f. ;8,16–18.21 ;10,35 ff.) und nicht immer so betont ist wie in 4,13 ;7,17 f.; 8,17 f. und zu dem auch der Tadel des Petrus in 8,30 und das Unverständnis gegenüber der Notwendigkeit des Leidens in 9,32 gehören, soll keineswegs eine Distanz zwischen Jesus und seinen Jüngern schaffen, sondern hat zumindest eine doppelte Funktion:
Doppelfunktion des Jüngerunverständnisses
(1.) Zum einen macht das Unverständnis der Worte und Taten Jesu auf seiten der Jünger immer wieder deren besondere Belehrung durch Jesus notwendig (4,14 ff.;7,18 ff. ;8,19 f.), so dass sie nach Ostern in der Tat besonders qualifizierte Zeugen des Jesusgeschehens sind, auf deren Überlieferung der Worte und Taten Jesu Verlass ist.
(2.) Zum anderen stellt das Unverständnis der Jünger diese aber zugleich in eine Reihe mit den Lesern des Markusevangeliums – wenn diese nicht alles sofort begreifen, müssen sie sich darüber weder wundern noch sich schämen, den Jüngern des Herrn ist es ganz genauso gegangen.
11.2 Die Parabeltheorie
Gleichnisse zur Verstockung des Volkes?
Nach Mk 4,10–12 sind die Gleichnisse gerade keine Verständnishilfe für die Botschaft Jesu, vielmehr dienen sie der Verstockung des Volkes. Diese sog. Parabeltheorie zeigt deutlich, wie weit die Entwicklung der Tradition weg vom Ursprung im Markusevangelium bereits fortgeschritten ist, denn dahinter steht ja offensichtlich die Meinung, dass die Gleichnisse Jesu mit ihren doch einfachen und schlichten Bildern für das einfache Volk nicht verstehbar sind und dass man eines besonderen Schlüssels für deren Verständnis bedarf.
Dieses markinische Verständnis der Gleichnisse wird diesen selbst nicht gerecht. Man kann das schon daran erkennen, dass Markus trotz der von ihm übernommenen Parabeltheorie nur für ein Gleichnis eine Deutung mitüberliefert – von den anderen geht auch er offensichtlich davon aus, dass sie ohne Deutung für alle und nicht nur für die eingeweihten Jünger verstehbar sind. Darüber hinaus hat Markus mit der Parabeltheorie noch einen weiteren Widerspruch übernommen, gelten doch nach dieser Theorie die Jünger als mit einem besonderen Wissen begabt, während sie nach dem übrigen Evangelium als eher unverständig und besonderer Belehrung bedürftig erscheinen.
Gerade von diesen Spannungen her muss m. E. die Frage noch einmal genau geprüft werden, ob die Verfasser der Evangelien sich ihren Stoff so zu eigen gemacht haben, wie das vor allem in den letzten Jahren unter Einfluss der Redaktionsgeschichte und der synchronischen Analyse vertreten worden ist. Diese Frage ist m. E. auch dann zu stellen, wenn man in Markus nicht den konservativen Redaktor sieht, wie ihn v. a. R. Pesch in seinem Markuskommentar gezeichnet hat. Die Evangelisten können wesentlich mehr selbständige Autoren gewesen sein, als es die Formgeschichte angenommen hat, ohne dass sie sich mit allem und jedem, das sie aus der Tradition übernahmen, identifizierten, zumal bei Markus ja noch die kaum zu klärende Frage offen ist, ob nicht auch er schon, wie Matthäus und Lukas es dann für uns nachvollziehbar getan haben, Stoff aus dem ihm überkommenen Material weggelassen hat.
Wir haben als Interpreten m. E. die Pflicht, aufeinander zu beziehen, was aufeinander beziehbar ist, und im Zweifelsfalle die Dinge für miteinander vereinbar zu halten, die der Evangelist in sein Werk integriert. Aber bei dem unmittelbaren Nebeneinander der von Gott (vgl. das theologische Passiv in 4,11) den Jüngern geschenkten Erkenntnis und deren Unverständnis gegenüber der Gleichnistradition insgesamt (4,13) stellt sich doch die Frage, ob der Evangelist auf diese Spannung zwischen seinen Überlieferungen aufmerksam geworden ist und beide Dinge zusammengebracht hat. Hat er es nicht, brauchen auch wir es nicht zu können. Und lassen sich die gottgeschenkte Erkenntnis und die Sonderbelehrung, die auf die Notiz über das Unverständnis der Jünger folgt, überhaupt miteinander vereinbaren?
Читать дальше
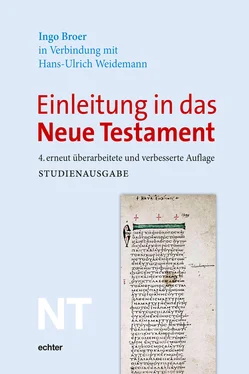
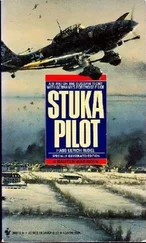


![Felix Sobotta - Das alte Jagdschloss und das neue Haus [Band 1]](/books/493473/felix-sobotta-das-alte-jagdschloss-und-das-neue-ha-thumb.webp)