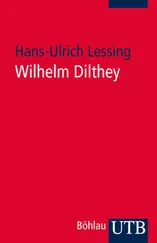Mk 13 und der jüdische Krieg
Über diese Frage dauern die Kontroversen seit Generationen an. Während die einen sich sicher sind, dass Mk 13,2 nur als vaticinium ex eventu, d. h. als eine fiktive Prophezeiung, die bereits auf das vorhergesagte Ereignis zurückblickt, zu verstehen ist, und der Verfasser des Markusevangeliums so bereits die Zerstörung Jerusalems kennt und voraussetzt, halten die anderen den Zeitpunkt der Zerstörung Jerusalems in Mk 13 noch für zukünftig, den Krieg aber für bereits in vollem Gange. Vergleicht man die Berichte des Flavius Josephus und des Dio Cassius über die Einnahme des Tempels und die Zerstörung Jerusalems, so legt sich die Annahme eines vaticinium ex eventu in der Tat nicht nahe, und es dürfte auch nicht von ungefähr kommen, dass Lukas das Motiv von Mk 13,2 erweitert und auf die ganze Stadt Jerusalem bezogen hat. Für die Bewertung dieses Tempelwortes spielt auch eine Rolle, dass entsprechende Weissagungen im Alten Testament und im Judentum zahlreich vorhanden sind (vgl. 1 Kön 9,7 f.;Jer 7,14;26,6.9.18;Mich 3,12;äHen 90,28). Vor nicht geringere Schwierigkeiten stellt die zweite zur Datierung des Markusevangeliums immer wieder herangezogene Stelle, Mk 13,14. Hier bereitet schon die Deutung erhebliche Probleme, weswegen auch hier nicht eindeutig ein vaticinium ex eventu zu identifizieren ist.
Krieg und Endzeit
Nimmt man aber den Bezug des Gesamttextes auf den Jüdischen Krieg wirklich ernst, d. h. führt seine Entstehung auf die Zeit des Krieges (66–70) zurück und beachtet die Unterscheidung zwischen Krieg und Endzeit, dann kommt es dem Text gerade darauf an, den Krieg noch nicht als das Ende, sprich die Wiederkunft Christi, anzusehen.
Ein vormarkinisches „Flugblatt“ in Mk 13?
Ist diese Deutung von Mk 13 zutreffend, so wird die Aufnahme dieser Rede bzw. ihrer traditionellen Teile – die einschlägigen Autoren rechnen in Mk 13 mit der Übernahme einer Vorlage, z. B. eines Flugblattes, durch den Evangelisten, wobei in diese Vorlage evtl. auch schon weiteres Traditionsmaterial, etwa aus der Zeit der Krise um die Aufrichtung der Statue Caligulas im Tempel von Jerusalem, eingegangen sein soll – in das Evangelium gut verständlich und diese setzt den Jüdischen Krieg voraus, wobei offen bleiben kann, wie weit der Krieg bei der Abfassung der Vorlage des Markus bereits gediehen war. Insofern Abfassung des Stückes und Abfassung des Evangeliums nicht dasselbe sind, wird zwischen beiden durchaus eine gewisse Zeitspanne liegen – die Vorlage musste von Jerusalem bzw. dessen Umgebung noch zu Markus gelangen! –, und bei der Abfassung des Evangeliums dürfte der Krieg dann in der Tat zu Ende gewesen sein, was den Nachvollzug der Aussage, der Krieg sei noch nicht das Ende der Welt, sicher erleichtert hat.
Es ist am einleuchtendsten, auch wenn eindeutige Hinweise in Mk 13 wie z. B. vaticinia ex eventu fehlen, mit einer Abfassung des Markustextes nach der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 zu rechnen. Diese Datierung wird gerade in letzter Zeit häufiger vertreten.
5. Der Abfassungsort des Markusevangeliums
5.1 Hinweise aus der Alten Kirche
Clemens und Irenäus als Zeugen für Rom
Die Abfassung des Markusevangeliums wird häufig nach Rom verlegt. Diese Annahme basiert wie die Zuschreibung des Evangeliums an Markus auf einer Nachricht aus der Alten Kirche, die direkt erstmals bei Clemens von Alexandrien (t vor 215) begegnet:
„Beim Evangelium nach Markus waltete folgende Fügung. Nachdem Petrus in Rom öffentlich das Wort gepredigt und im Geiste das Evangelium verkündet hatte, sollen seine zahlreichen Zuhörer Markus gebeten haben, er möge, da er schon seit langem Petrus begleitet und seine Worte im Gedächtnis habe, seine Predigten niederschreiben. Markus habe willfahrt und ihnen der Bitte entsprechend das Evangelium gegeben. Als Petrus davon erfuhr, habe er ihn durch ein mahnend Wort weder davon abgehalten noch dazu ermuntert. “ (Eusebius, Kirchengeschichte VI 14,6)
Da auch schon Irenäus von Lyon († um 200) die Petrus-Rom-Tradition kennt und Markus wie Papias als Schüler und Interpreten des Petrus bezeichnet (vgl. Haer. III 1,2, gr. überliefert bei Eusebius, Kirchengeschichte V. 8,2 f.), könnte auch er evtl. die Abfassung des Markusevangeliums in Rom voraussetzen. Zum Ausdruck bringt er dies direkt allerdings nicht. Auch im sog. anti-marcionitischen Prolog, der zwischen 160/180 und der Mitte des 3. Jahrhunderts entstanden sein dürfte, werden Petrus, Markus und Italien zusammen genannt. Die Romfrage ist auch deswegen von Bedeutung, weil es neuerdings einen gewissen Trend gibt, das Markusevangelium auf dem Hintergrund des römischen ► Kaiserkultes sozusagen als dessen Antityp zu lesen, was bei einer Abfassung in Rom natürlich wesentlich leichter wahrscheinlich zu machen wäre als bei einer Abfassung in Syrien.
5.2 Hinweise mit Hilfe der Sprache des Markusevangeliums
In der neueren Diskussion hat man diese Nachricht dadurch abzusichern versucht, dass man das Markusevangelium nach Latinismen durchforscht hat, und man ist dabei durchaus auch fündig geworden.
Die Latinismen als Hinweis auf Rom?
Worte wie Caesar, census (12,14 Vermögensschätzung, Volkszählung), centurio (15,39.44 f. Führer einer Zenturie), flagellare (15,15 auspeitschen), legio (5,9.15 Legion) und praetorium (15,16 Amtswohnung des Statthalters) begegnen bei Markus insgesamt auffällig häufig, sind aber wohl dennoch kein Beweis für die Abfassung des Markusevangeliums in Rom, da nicht nur die Latinismen, sondern auch die Prägung der markinischen Sprache durch das Hebräische und Aramäische deutlich sind und die Herkunft der Latinismen durch die Anwesenheit der Römer im Osten genügend erklärbar ist. Dafür, dass die Anwesenheit der Römer als Erklärung genügt, spricht, dass die meisten der genannten Worte auch als Lehnworte Eingang in die Sprache der Rabbinen gefunden haben. So fehlt bei den o. g. Worten in Bauer / Alands Wörterbuch zum griechischen Neuen Testament nur zu praetorium der Hinweis auf die Übernahme in die rabbinische Sprache.
Die Ambivalenz der Argumente wird im übrigen schön deutlich, wenn man sieht, wie Ebner in seiner Einleitung (171) in Mk 12,42 mit der Erwähnung der kleinsten römischen Münze, des Quadrans, das entscheidende Argument für eine Abfassung in Rom findet, während Theissen (Entstehung 79) gerade unter Verweis auf diese Stelle gegen Rom plädiert.
Massiv gegen Rom spricht m. E. aber der Umstand, dass Markus der erste ist, der in großem Umfang das mündlich in den Gemeinden umlaufende Material sammelt (was kleinere Vorgänger-Sammlungen nicht ausschließt, s. u. Nr. 7 und oben § 4 zur Logienquelle Q) und in den Zusammenhang eines Lebens Jesu bringt. Dafür war er auf eine gewisse Nähe zum Ursprung und zum Zentrum der Jesusbewegung angewiesen.
Nähe zum Ursprung der Jesusbewegung
Es ist kaum denkbar, dass die Traditionen, die in das Markusevangelium Eingang gefunden haben, allesamt schon um das Jahr 70 auch in Rom bekannt gewesen sind. Schon Paulus dürfte sie ja trotz mehrmaligen Aufenthaltes in Jerusalem nicht oder jedenfalls nicht viele davon gekannt haben, sonst hätten sich sicher mehr Spuren davon in den Paulusbriefen erhalten als die drei Herrenworte, auf die Paulus ausdrücklich Bezug nimmt (1 Kor 7,10 f.;9,14;11,23 ff.;[1 Thess 4,13 ff.]).
Auch eine deutlich noch vorhandene Nähe zum Judentum – jüdische Fragen spielen durchaus noch eine Rolle im Markusevangelium, vgl. z. B. 7,1–15 oder die Auseinandersetzungen mit den jüdischen Gruppen in den Streitgesprächen sowie die Nähe zum Jüdischen Krieg in Mk 13 – lassen es nicht geraten sein, das Markusevangelium zu weit vom jüdischen Mutterland entfernt entstanden zu denken, wenngleich die an der Erläuterung jüdischer Sitten erkennbare Ausrichtung zumindest auch auf Heidenchristen eine Entstehung in Judäa oder Galiläa ausschließt.
Читать дальше
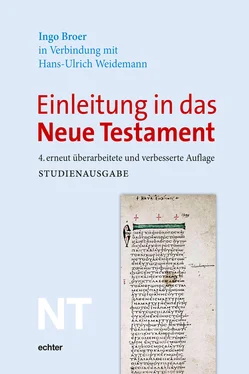
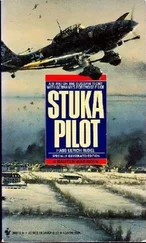


![Felix Sobotta - Das alte Jagdschloss und das neue Haus [Band 1]](/books/493473/felix-sobotta-das-alte-jagdschloss-und-das-neue-ha-thumb.webp)