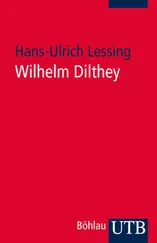Das Markusevangelium erfordert die Annahme einer gewissen Distanz, aber zugleich einer gewissen Nähe zu Palästina. Diese beiden Bedingungen erfüllt am ehesten der syrische Raum, so unbefriedigend diese allgemeine Zuweisung ist. Das Markusevangelium dürfte also am ehesten in Syrien entstanden sein.
6. Die markinische Gemeinde
Gemeinde aus Juden- und Heidenchristen
Die gleichzeitige Distanz und Nähe zum Judentum – einerseits interessieren Fragen des Gesetzes noch so, dass die darum kreisenden Perikopen in das Evangelium aufgenommen werden, andererseits kommt aber eine gesetzestreue Haltung offensichtlich nicht mehr in Frage und Gesetzesbräuche müssen sogar erläutert werden – ist am ehesten als Hinweis auf eine aus Heiden-und Judenchristen gemischte Gemeinde zu verstehen, weil man andernfalls annehmen müsste, Markus habe die jüdische Gesetzesfragen behandelnden Perikopen allein aus historischem Interesse in sein Werk übernommen.
Zwar ist solches Interesse gerade bei Markus nicht von vornherein auszuschließen, weil zum einen die Sorge um den Verlust und das Zerredetwerden der Tradition ein wichtiges Motiv für die Abfassung seines Werkes gewesen sein könnte, und zum anderen keineswegs alle Züge in seinem Werk bzw. in den Einzelperikopen auf ein aktuelles Interesse zurückgeführt werden können, obwohl diese Behauptung dem gegenwärtigen Trend der Forschung eher zuwiderläuft. Aber die Übernahme einer Vielzahl von entsprechenden Traditionen spricht doch dafür, dass an ihnen auch ein Interesse in der Gemeinde des Markus bestand und dieses wird am ehesten in einer zumindest auch judenchristlich beeinflussten Gemeinde verständlich.
Der Vielzahl der im Einzelnen erörterten Ungenauigkeiten in palästinischer Geographie und jüdischen Bräuchen bei gleichzeitigem Interesse an diesen wird vielleicht am ehesten die Annahme gerecht, im Verfasser des zweiten Evangeliums einen heidnischen Frommen aus dem Umkreis der Synagoge, also einen früheren sog. Gottesfürchtigen, zu sehen, der für eine aus Juden- und Heidenchristen gemischte Gemeinde schreibt.
Der Evangelist und seine Gemeinde
Die Gemeinde des Markus hat sowohl die Traditionen, die er in seinem Evangelium verarbeitet, als auch den theologischen Standpunkt des Markus mit Sicherheit in erheblichem Maße beeinflusst, allerdings wird dies aller Wahrscheinlichkeit nach auch ein Vorgang auf Gegenseitigkeit gewesen sein. Inwieweit er bei seiner Arbeit vor allem seine eigene Gemeinde im Blick hatte, wissen wir nicht. Dass er auch für sie geschrieben hat, ist von vornherein wahrscheinlich, dass er ausschließlich für sie geschrieben hat, ist angesichts der literarischen Eigenart seines Werkes weniger naheliegend, was nun wiederum nicht meint, dass er sein Erzählwerk von vornherein als bevorzugtes Instrument der weltweiten Verkündigung des Evangeliums, von der er ja selbst zweimal spricht, angesehen hat.
Die angezielte Leserschaft
Da Markus sich entschieden hat, keinen Brief, sondern ein Evangelium zu schreiben, und dies mit Hilfe der in seiner Gemeinde umlaufenden und auch sonst erreichbaren Traditionen zu tun, kann er durchaus von Anfang an eine Leserschaft angezielt haben, die weit über den Rahmen seiner Heimatgemeinde hinausging, ja, angesichts der Tatsache, dass er der Erste war, der die Traditionen umfassend zu sammeln versuchte, kann die Absicht, ein Werk für die ganze Kirche zu schreiben, jedenfalls nicht von vornherein völlig ausgeschlossen werden. Denn das, was Markus für die Einzelperikope akzeptiert (Mk 14,9), könnte er durchaus auch auf sein Werk übertragen haben (Mk 13,10).
Die Perspektive des Markusevangeliums geht über die Gemeinde des Verfassers hinaus und schließt möglicherweise die ganze Kirche ein.
7. Der Markusschluss
Fortsetzung hinter Mk 16,8?
Die Bibelausgaben und-Übersetzungen bieten zwar hinter Markus 16,8 noch weiteren Text, es wird aber immer darauf hingewiesen, dass es sich dabei nach Ausweis der ► Handschriften um eine spätere Hinzufügung handelt, die im zweiten Jahrhundert entstanden sein dürfte, wenn auch ihre älteste textliche Bezeugung wesentlich jünger ist.
Dass auf die Flucht der Frauen vom Grabe Jesu keine Fortsetzung mehr erfolgt sein soll, ist nicht nur angesichts der Fortsetzungsberichte der ► Seitenreferenten, sondern auch innerhalb der Erzählung des Markus überraschend. Denn der Engel erteilt den Frauen im Grabe ausdrücklich den Befehl, die Jünger von der bevorstehenden Erscheinung des Auferstandenen in Galiläa in Kenntnis zu setzen, und auch der irdische Jesus hat in 14,28 auf ein Treffen nach der Auferstehung in Galiläa verwiesen.
Deswegen wurde im Laufe der Forschung immer wieder eine ursprüngliche Fortsetzung postuliert, die im Laufe des Überlieferungsprozesses verloren gegangen sein sollte, und es wurden auch immer wieder Rekonstruktionen dieses angeblich verlorenen Markusschlusses vorgelegt. Jedoch ist der Verlust eines Blattes in den ältesten ► Handschriften genau an dieser Stelle, wo ja die Perikope von der Auffindung des leeren Grabes mindestens zu einem gewissen Abschluss gekommen ist, sehr schwer zu erklären, zumal dieser Verlust schon sehr früh, zumindest vor der Abfassung des Matthäus- und Lukas Evangeliums, erfolgt sein müsste, da die Seitenreferenten hinter Mk 16,8 erkennbar eigene Wege gehen und offensichtlich in ihrer Mk-Quelle für diese Fortsetzung keinen Stoff mehr gefunden haben. Der an sich überraschende Schluss mit dem Ungehorsam der Frauen gegenüber dem Engelbefehl ist dann weniger überraschend, wenn man darauf achtet, wie sehr der Evangelist innerhalb seines Werkes Widersprüche zwischen Schweigen und Reden schafft (vgl. dazu unten 11.1.1)
Es gibt gute Gründe für die Annahme, dass der ursprüngliche Text des Markusevangeliums mit 16,8 endete und dass der Ungehorsam der Frauen gegenüber dem Befehl des Engels vom Evangelisten bewusst gestaltet wurde. Ohne die auf die Erzählung von der Auffindung des leeren Grabes bei Matthäus und Lukas folgenden Erscheinungserzählungen hätte wohl niemand eine Fortsetzung des Markusevangeliums hinter 16,8 erwartet.
8. Die Quellen des Markusevangeliums
Welche Quellen dem Verfasser des Markusevangeliums schriftlich vorgelegen haben, ist nach wie vor umstritten, aber hinsichtlich einiger Kapitel gibt es doch weit verbreitete Zustimmung, dass Markus hier auf eine vormarkinische Sammlung zurückgreifen konnte.
Das gilt vor allem für die Sammlung der Streitgespräche in 2,1–3,6, für die Gleichnisse in Kap. 4, natürlich mit Ausnahme von 4,11 f., für das Spruchmaterial in 10,1–12.17–27.35–45 und Teile der Passionsgeschichte, wobei man sich in der Regel auf 14–16 beschränkt und der von R. Pesch u. a. in seinem Markus-Kommentar vertretenen Ansicht, Markus benutze bereits ab 8,27 ff. weitestgehend eine ihm vorliegende, sehr alte und aus der Jerusalemer Urgemeinde stammende Passionsgeschichte, nicht folgt. Darüber hinaus kommen auch die Wundergeschichten in 4,35 ff. und Teile der synoptischen Apokalypse (s. o. Nr. 4.3) als Teile vormarkinischer Sammlungen in Frage.
Selbst neuere Arbeiten, die die Einheitlichkeit des Stiles des zweiten Evangeliums und die daraus resultierende Schwierigkeit, die dem Evangelium zugrunde liegenden Quellen noch erheben zu können, betonen, gehen nicht davon aus, dass der Evangelist sein Werk ohne Quellen verfasst hat.
9. Das Problem des Urmarkus
Ur- oder Deuteromarkus
Auch heute noch wird in der Forschung, wie beim Problem der synoptischen Frage kurz erwähnt, gelegentlich die Annahme vertreten, nicht der Verfasser des uns heute vorliegenden Markusevangeliums habe als erster die Gattung Evangelium geschaffen, sondern er habe bereits einen Vorgänger gehabt.
Für diese Annahme stützt man sich vor allem auf die Übereinstimmungen zwischen den Evangelien des Matthäus und Lukas gegen Markus im mit dem Markusevangelium gemeinsamen Stoff (also auf die sog. „kleineren Übereinstimmungen“) und auf die sog. „große“ oder „lukanische“ Lücke im Lukasevangelium, in der Mk 6,45–8,26 ausgelassen sind und die Lukas in seiner Markusvorlage deswegen nicht gefunden haben soll.
Читать дальше
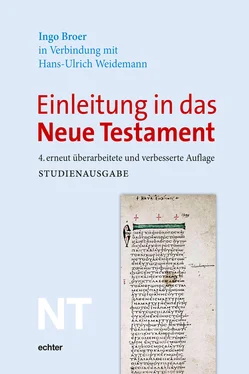
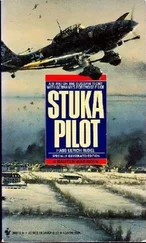


![Felix Sobotta - Das alte Jagdschloss und das neue Haus [Band 1]](/books/493473/felix-sobotta-das-alte-jagdschloss-und-das-neue-ha-thumb.webp)