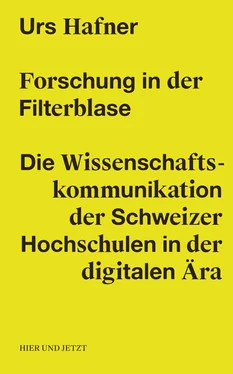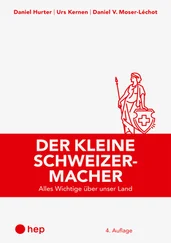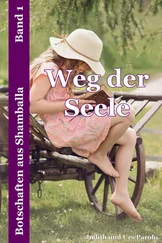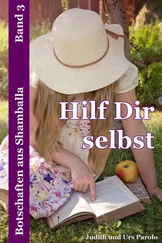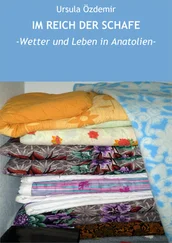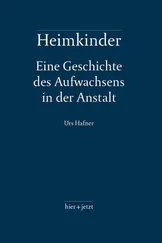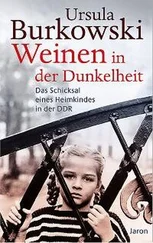Die deutsche Stiftung Wissenschaft im Dialog hat 2016 die «Leitlinien der guten Wissenschafts-PR» aufgestellt. 28Sie umfassen eine ganze Menge, nämlich dass die gute Wissenschaftskommunikation das Verständnis für die Arbeitsweise der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stärkt; die Ängste und Vorbehalte der Bürgerinnen und Bürger in die Wissenschaften trägt; aus der «Fülle der Informationen» die für die Gesellschaften relevanten herausarbeitet; «faktentreu» vorgeht; Grenzen, Interessen und Finanzen der Forschung transparent macht; Informationen zielgruppengerecht aufbereitet; «wertegeleitet» vorgeht. Die Werte sind unter anderen folgende: Nutzen für die Gesellschaft, Transparenz, Offenheit der Wissenschaft für den Dialog, Selbstkritik, Unabhängigkeit, die Prinzipien der guten wissenschaftlichen Praxis. Die «Leitlinien» sind ein irritierendes Papier. Sie wollen in einer medial sich im Umbruch befindenden Realität – die Stichworte seien: soziale Netzwerke, wachsende Wissenschafts-PR, boulevardisierte Wissenschaftskommunikation – Orientierung und Gegensteuer geben. Das Unterfangen ist gut gemeint, aber vor allem symptomatisch. Denn wenn eine Branche sich explizit Werte gibt, an denen man sich orientieren soll, ist zu vermuten, dass sie in eine Krise geraten ist. Die «gute Praxis» ergibt sich in der Regel aus der Berufspraxis selbst, in die mehr oder weniger vernünftige Menschen eingeführt werden. Wer jahrelang in der Kommunikationsabteilung einer Universität tätig war und plötzlich vorgesetzt bekommt, er solle transparent, offen und selbstkritisch arbeiten, wird irritiert sein, denn implizit wird ihm unterstellt, dass er bisher intransparent, verschlossen und beratungsresistent gewirkt habe. Und wer neu in dieses Berufsfeld eintritt, wird sich fragen, ob man denn hier nicht faktentreu gearbeitet habe?
Die «Leitlinien» sind ein Symptom der von der Politik gesteuerten Autonomisierung und Verbetrieblichung der Hochschulen. Sie bedeutet für die Wissenschaftskommunikation, dass sie stärker als bisher der Strategie der Hochschulen folgen muss. Sie ist eben nicht unabhängig, sondern steht im Dienst einer Hochschule, die im verschärften internationalen Bildungswettbewerb um Drittmittel, angesehene Professoren, wohlhabende Studierende und bessere Positionen in Rankings kämpft. Hilflos sind die Ausführungen, die sich auf die Wissenschaften beziehen; eine, die mit Leib und Seele Forscherin ist, würde auf sie mit Unverständnis reagieren, ist zu vermuten. Soll sie sich etwa von den «Ängsten» eines uniformierten Dilettanten von ihren Experimenten abhalten lassen? Damit würde sie ihr wissenschaftliches Ethos verraten. Und sie schafft neue Ergebnisse, validierte Resultate, wohlformulierte Erkenntnisse, aber keine «Informationen». Diese liefern der Auskunftsdienst und das Nachschlagewerk, nicht aber die Forschenden; die Früchte ihrer Arbeit so zu bezeichnen, kommt deren Geringschätzung gleich. Schliesslich: der «Nutzen für die Gesellschaft». Die Hochschulen werden nicht müde zu betonen, dass Wissenschaft und Forschung der Gesellschaft vielfältig nützen, auch ökonomisch. Die Nutzendiskussion aber ist komplex, vertrackt und für die Wissenschaften gefährlich. Der ökonomische Nutzen eines universitär angestossenen Start-ups bedeutet noch lange nicht den ökonomischen Nutzen für alle. Hat die Gesellschaft einen Nutzen von Robotern in Altersheimen? Von Geoengeneering? Oder von Bürgerinnen und Bürgern, die durch Forschung zur Selbstreflexion angehalten werden?
Die Stiftung SeC agiert zurückhaltender als ihr deutsches Pendant. Historisch bildet SeC in der Schweiz die nationale Verkörperung der Wissenschaftskommunikation schlechthin. Nach eigenen Angaben fördert die siebenköpfige Stiftung, die den Akademien der Wissenschaften Schweiz angeschlossen ist, «den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Sie setzt sich für die Wertschätzung und das Verständnis aller Wissenschaften ein und thematisiert deren Chancen und Grenzen. SeC fördert die Rückmeldungen der Zivilbevölkerung an die Wissenschaften, im Besonderen über Wertefragen.» 29
Drei strategische Schwerpunkte verfolgt die Stiftung: erstens den «direkten Dialog zwischen Forschenden und Bürgerinnen und Bürgern» – dies vor allem mittels der klassischen «Wissenschaftscafés», an denen Forschende und Leute aus der Berufspraxis sich mit dem Publikum über aktuelle Themen unterhalten, etwa über interreligiöse Paarbeziehungen, die Faszination des Gehirns, die Zukunft Berns oder den Kindergarteneintritt. An manchen Veranstaltungen nehmen bis zu 200 Personen teil. Auffällig ist, dass die Themen in der Regel wenig kontrovers, wenig «intellektuell» und sehr «angewandt» sind. Die Fachhochschulen sind stärker vertreten als die Universitäten. Der zweite Schwerpunkt der Stiftung ist neu die digitale Interaktion, für die eigens ein Social-Media-Manager eingestellt wurde. Er betreut die Kanäle der sozialen Netzwerke. Auf Facebook etwa wirbt SeC mit Videos vor allem für Citizen-Science-Projekte: Die Leute sollen weniger Plastik verbrauchen, um die Verschmutzung der Weltmeere zu stoppen. Die Anzahl der Facebook-Abonnenten beträgt 1200 (Stand Juli 2018). Der dritte Schwerpunkt fördert den Dialog zwischen den Akteuren der Wissenschaftskommunikation mit einem zweijährlich stattfindenden Kongress.
In den letzten Jahren hat SeC einen Bedeutungsverlust hinnehmen müssen. Um 2012 diskutierte das Parlament gar die Abschaffung der Stiftung; ihr Budget wurde halbiert, ein neues Team trat an. Die Stiftung hatte sich in ihrer damaligen Form überlebt. Sie war 1998 vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation im Nachgang zur abgelehnten Genschutzinitiative gegründet worden, die den «Schutz von Leben und Umwelt vor Genmanipulationen» forderte. Die Wissenschaftsverwaltung und die Industrie stellten erschreckt fest, dass ein Graben zwischen Wissenschaft und Bevölkerung klaffe, der die Forschung bedrohe. Hinter der Stiftung standen die vier Akademien der Wissenschaften der Schweiz, der SNF sowie der Handels- und Industrieverein (heute Economiesuisse). Gut dotiert organisierte sie 2002, 2005 und 2009 grosse Wissenschaftsfestivals, dazu Bürgerforen und die Wissenschaftscafés. SeC agierte unter dem Paradigma des «Dialogs auf Augenhöhe», den sie nun erweitert hat um die Interaktion in den sozialen Netzwerken und die Partizipation im Rahmen der Citizen-Science-Projekte.
SeC war eine der ersten Institutionen der Schweiz, die im grossen Stil Wissenschaftskommunikation nach dem Dialogprinzip betrieb. Heute organisieren die meisten Hochschulen ihre eigenen Wissenschaftsfestivals und Wissenschaftscafés, an denen sie sich selbst und ihr Personal in Szene setzen. In den urbanen Zentren, namentlich im Raum Zürich mit seiner grossen Universität, der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, sei SeC deshalb zum Beispiel kaum mit Veranstaltungen präsent, sagt Geschäftsführer Philipp Burkard. Die Stiftung bearbeite strategisch Nischen, sowohl geografisch als auch thematisch, zum Beispiel in mittelgrossen Städten und auf dem Land: Da könne man Hemmschwellen abbauen. Wenn man Wissenschaftskommunikation nicht auf die Hochschulen beschränke, sondern weiter fasse und also auch Museen, Zoos und botanische Gärten miteinbeziehe, dann sehe man, dass diese Kommunikation sehr wohl etwas bringe.
Der Wissenschaftsbarometer Schweiz bestätige, dass die meisten Leute wissenschaftsfreundlich seien, sagt Burkard. SeC wolle zudem zeigen, dass die Wissenschaftskommunikation nicht nur Ergebnisse darstelle und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich uneinig seien, denn Wissenschaft sei ein diskursives Feld. Eine zeitgemässe Wissenschaftskommunikation trage nicht nur Erfolgsstorys vor, denn die Wissenschaft sei kein ideales System und bringe auch enttäuschende Resultate hervor.
Читать дальше