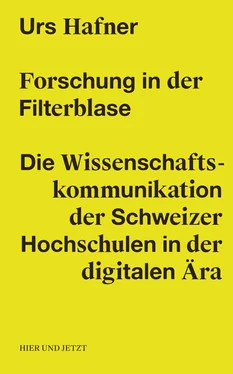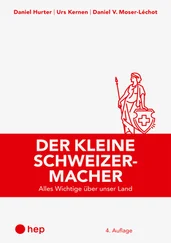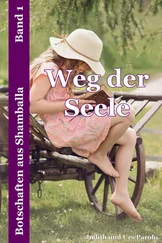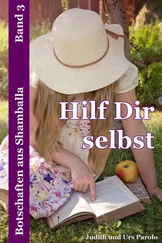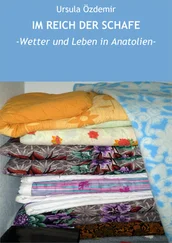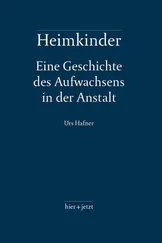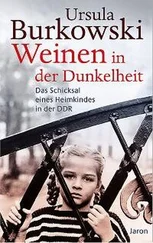Es zeigt sich: Die Reputation der Hochschulen steht über allem. Hat die Studentin noch vor zwanzig Jahren ihr Fach an einer Universität belegt, so studiert sie heute bei einem «UZH-Forscher». Das Branding der Hochschulen – UZH steht natürlich für Universität Zürich – und die Hervorhebung ihrer Forschungserfolge gehen einher mit ihrer unternehmerischen Profilierung und dem verschärften Bildungswettbewerb. Auf kommunikativer Ebene stechen die Institutionen des Bundes, die Eidgenössischen Technischen Hochschulen, hervor. Die neuen Möglichkeiten werden von den Wissenschaftskommunikatoren nicht nur als Chance und Bereicherung, sondern auch als Überforderung wahrgenommen. Eine mögliche Antwort darauf ist: Masse. Es sieht so aus, als ob der Bann der Quantität heraufzöge: «Post it or perish!» – um die berüchtigte, mittlerweile selbst von Forschungsförderungsorganisationen unter Beschuss geratene Wissenschaftlerdevise «publish or perish» zu paraphrasieren.
Heute ist die Wissenschaftskommunikation in der Öffentlichkeit viel stärker präsent als der üblicherweise auf die Naturwissenschaften ausgerichtete Wissenschaftsjournalismus. Diesem widmet sich das Kapitel «Unter Druck: Der Wissenschaftsjournalismus»: Wie ist er in der Schweiz aufgestellt, wie geht er den Umbruch in den Medien an? Dass der Wissenschaftsjournalismus mit Existenznöten kämpft, ist kein neuer Befund, macht diesen deswegen aber nicht weniger akut. In der Demokratietheorie der Gewaltenteilung kommt dem Wissenschaftsjournalismus eine wichtige Funktion zu: Er soll den Bürgerinnen und Bürgern dabei helfen, darüber zu diskutieren, welche Forschung die Gesellschaft braucht. Und er sollte das Forschungsmanagement aufmerksam beobachten.
Schliesslich werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die selbst Wissenschaft unter die Leute bringen, porträtiert. Ihre Tätigkeit wird vom Aufstieg der sozialen Netzwerke begünstigt. Manche Professorinnen setzen auf Twitter, andere auf Blogs und Webportale. Die Forschenden erzielen zum Teil erstaunliche Reichweiten, und sie kommen direkt mit den Medien in Kontakt, ohne die Vermittlung von Kommunikationsprofis. Allerdings zeigt sich, dass sie die nichtakademische Öffentlichkeit in der Regel kaum erreichen.
Das Fazit ziehe ich in Form von vier Thesen: Die konstatierten Sachverhalte sowie die Lösungsvorschläge werden provokativ zugespitzt. Sie sollen die Realität transzendieren. Drei Begriffe sind zentral: Reputationsmanagement, Erwartungsüberschuss, Reflexionswissen. Sie verdichten die Mängel wie auch das Potenzial der Wissenschaftskommunikation und des Wissenschaftsjournalismus. Wahrscheinlich stärkt die intensivierte Nutzung der sozialen Netzwerke das Erscheinungsbild der Hochschulen. Für das vertiefte Verständnis der Wissenschaften in der Öffentlichkeit leisten die Social Media aber wenig. Dafür bräuchte es einen radikalen Wissenschaftsjournalismus.
Wozu soll die Kommunikation der Ergebnisse der Wissenschaften, also die an die Öffentlichkeit gerichteten Mitteilungen zur Praxis der Forschung, gut sein, wenn nicht für die Gestaltung einer für alle lebenswerten Gesellschaft? Zu glauben, dieses Ziel erreichten die Wissenschaften und ihre Verwalter von sich aus, hiesse einmal mehr, einer technokratischen Fantasie aufzusitzen – wie es die Apostel der Digitaltechnik tun, wenn sie verkünden, die «Science» werde mit «Big Data» die Demokratie retten. Plato schwebte ähnliches vor, einfach ohne Netz. Es ist komplizierter. Der Historiker Walter Scheidel hat kürzlich zu bedenken gegeben, dass vielleicht bald eine «biomechatronisch» optimierte Elite über die Normalsterblichen herrschen werde. 1Die Segnungen der Technik kommen nicht allen zugute. Es ist umgekehrt: Wenn schon, müssen die Bürgerinnen und Bürger die Demokratie retten. Die Wissenschaften können ihnen dabei nur helfen, wenn sie sich ihrerseits helfen lassen von den Kommunikatorinnen und Journalisten.
Dieses Buch hat den Anspruch, eine dichte Beschreibung der wissenschaftskommunikativen Landschaft der Schweiz zu liefern. Zum einen schöpfe ich aus meiner langjährigen Erfahrung als Wissenschaftsjournalist und Wissenschaftskommunikator (so habe ich von 2007 bis 2014 für den Schweizerischen Nationalfonds die Öffentlichkeitsarbeit für die Sozial- und Geisteswissenschaften verantwortet). Zum anderen habe ich für diese Studie über dreissig Interviews geführt, überwiegend mit den Kommunikationschefs von Schweizer Hochschulen, dazu mit Wissenschaftsjournalisten und kommunikationsaffinen Professorinnen. Ergänzend habe ich unter den Hochschulen eine Umfrage zum Social-Media-Gebrauch gemacht sowie ihre Webseiten, sozialen Netzwerke und Wissenschaftsmagazine analysiert (siehe Anhang). Vier der Interviews habe ich in San Francisco, Berkeley und Stanford geführt. Die letzten Recherchen und der Abschluss des Buches erfolgten in San Francisco.
Dank der Unterstützung von Swissnex San Francisco, einer Einrichtung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation, haben viele Kommunikationsstellen von Schweizer Hochschulen den Sprung ins digitale Zeitalter geschafft. Ich meinerseits bin Swissnex dankbar für die Benutzung seiner Online-Umfragen sowie die freundliche Betreuung vor Ort und die Begleichung meiner Mietkosten. Apropos Geld: Dieses Buch ist grosszügig von der Gebert Rüf Stiftung finanziert worden. Für die Druckkosten ist unkompliziert die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften aufgekommen. Namentlich geht mein herzlicher Dank an: Michael Bürgi, Jon Mathieu, Marco Vencato und Mirjam Janett für das Gegenlesen und Kommentieren des Manuskripts, Philipp Dubach für Hinweise auf die US-Ökonomen-Blogszene, Sheila Fakurnejad für die Vermittlung der Kontakte in San Francisco und schliesslich alle Interviewpartnerinnen und -partner für die Zeit, die sie sich genommen haben.
Wissenschaft kommunizieren: Von der Demonstration zur Partizipation
Wenn eine Professorin einen Tweet mit Link zu einem ihrer Paper oder in einer Zeitung einen Artikel veröffentlicht, wenn die Kommunikationsstelle einer Universität eine Medienmitteilung publiziert oder den Kurzfilm zu einem neuen Labor auf YouTube hochlädt, wenn ein Massenmedium über ein neues Forschungsresultat oder die Verleihung eines Wissenschaftspreises berichtet, wenn schliesslich Forschende sich mit anderen Forschenden oder mit Laien über ihre Arbeit unterhalten: Dann werden in der einen oder anderen Weise Wissenschaft und Wissen vermittelt und – kommuniziert. Die Wissenschaftskommunikation ist in vieler Munde, der Begriff deckt ein weites Feld ab. Er ist also unscharf. Wer sich mit anderen über Wissenschaftskommunikation unterhält, kommt nicht umhin, den Begriff zu klären. Zuweilen wird er gar mit Kommunikationswissenschaft verwechselt: Dann ist die babylonische Verwirrung garantiert. Der Begriff fordert von seinen Benutzerinnen und Benutzern also definitorische Klärung ein, mithin kommunikatives Handeln im Sinne des Sozialphilosophen Jürgen Habermas: Was meinen wir und warum, wenn wir zu anderen von Wissenschaftskommunikation reden? 2
Der Kommunikationswissenschaftler Mike S. Schäfer, eine der führenden Stimmen an der Forschungsfront zur Wissenschaftskommunikation, hat folgende Definition aufgestellt: «Wir verstehen Wissenschaftskommunikation als alle Formen von auf wissenschaftliches Wissen oder wissenschaftliche Arbeit fokussierter Kommunikation, sowohl innerhalb als auch ausserhalb der institutionalisierten Wissenschaft, inklusive ihrer Produktion, Inhalte, Nutzung und Wirkungen.» 3Die Definition besagt, dass sowohl interne und externe, also nach aussen gerichtete Wissenschaftskommunikation, als auch Wissenschaftsjournalismus, Wissenschafts-PR und schliesslich auch Wissenstransfer und Wissenskommunikation zur Wissenschaftskommunikation zählen. Kurzum: Alles, was kommunikativ irgendwie mit Wissenschaft zu tun hat, fällt unter Wissenschaftskommunikation, selbst die Versuche der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ihr Wissen nicht nur einem breiteren Publikum, sondern auch fachfremden Kollegen näherzubringen.
Читать дальше