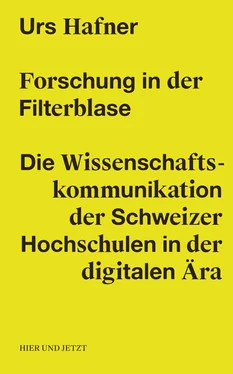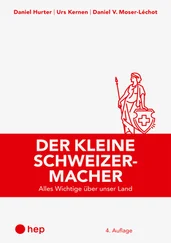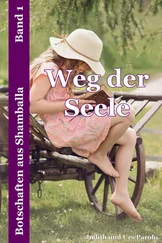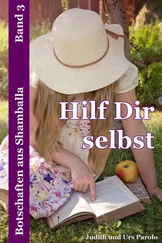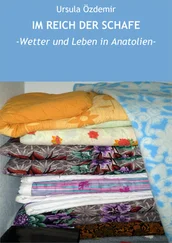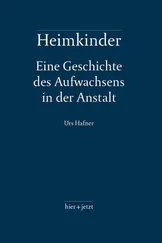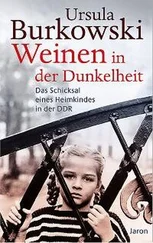Diese Art von Kommunikation wird heute etwa vom Netzwerk Future, einem Verbund von Hochschulen, Wissenschaftlern und Politikerinnen, oder von Swissuniversities betrieben, der Rektorenkonferenz der schweizerischen Hochschulen – mit dem Unterschied, dass heute Kommunikationsprofis am Werk sind, wo von Muralt das Engagement seinesgleichen vorschwebte. Man kommt nicht umhin, den ideologischen Charakter seiner Zeilen zu bemerken – ideologisch in dem Sinne, dass das Eigeninteresse der Akademiker als das Interesse aller beziehungsweise das Nationalinteresse ausgegeben wird. Denn selbst wenn man konzediert, dass die Wissenschaften eine tragende Rolle spielen: Mit welchem Recht behauptet der Professor, dass das ganze Volk überzeugt davon sein müsse, die Förderung der Wissenschaft sei notwendig? Mit gleichem Recht könnte der Landwirt behaupten, dem der Nutzen von Wissenschaft und Forschung ganz und gar nicht einleuchtet, dass die Förderung der Landwirtschaft im Interesse des ganzen Landes sei. Womit er nicht unrecht hätte.
Die 1980er-Jahre also markieren die Geburtsphase der modernen Wissenschaftskommunikation. 1985 veröffentlichte die Royal Society of London, die ehrwürdige, 1660 gegründete Akademie der Wissenschaften des Vereinigten Königreichs, den «Bodmer Report», der das aus heutiger Sicht paternalistische Konzept des «Public Understanding of Science» begründete: Der Wissenschaftler erklärt dem Laien die Welt. 23Die Motivation war in etwa die gleiche wie die von Muralts: Die Wissenschaften brauchen für ihre Existenz mehr gesellschaftlichen Support. Aber die Bedingungen hatten sich geändert. Neben der Forschungsskepsis waren – zumindest in England – PR-Organisationen entstanden.
Die Annahme der Royal Society war einfach: Weil die Bürgerinnen und Bürger zu wenig über Naturwissenschaften und Technik Bescheid wüssten, seien sie gleichgültig oder feindlich eingestellt, dabei wären sie doch im Grunde sehr wohl wissbegierig. Es erginge sowohl der Nation als auch den Individuen besser, wenn die Öffentlichkeit ein vertieftes Verständnis von Wissenschaft hätte. Daher seien die Wissenschaften und namentlich die Statistik besser im Schulunterricht zu verankern, die Lehrer gründlicher auszubilden und die Bibliotheken besser zu finanzieren, und es brauche mehr wissenschaftliche Vorträge für interessierte Personen und vor allem für die Kinder. Die Royal Society plädierte indes nicht für ein schönfärberisches Wissenschaftsverständnis – und schon gar nicht einfach für «Fact News»: «Understanding includes not just the facts of science, but also the method and its limitations as well as an appreciation of the practical and social implications.» 24Die Grenzen der Wissenschaft aufzuzeigen heisst zu sagen, was sie dank welchen Methoden kann, aber auch, was sie nicht kann.
Der «Bodmer Report» nahm die Medien ins Visier: Sie müssten mehr über die Wissenschaften berichten. Einfach sei das jedoch nicht: «The scientific community and the media work in very different ways and are, on the whole, often ignorant of each others’ procedures and constraints.» 25Um dies zu ändern, schlug die Royal Society vor, dass die Chefredaktoren ihre Journalisten ermuntern sollten, mehr wissenschaftliche Themen in ihre Berichte einzubauen. Und zweitens müssten die Wissenschaftler lernen, mit Journalisten zu kommunizieren. Sie dürften diese Aufgabe nicht delegieren. Die Royal Society sprach Klartext – so klar, ist zu vermuten, wie ein Wissenschaftler zu einem Journalisten sprechen müsste: «In the past, professional scientists have mostly delegated to others the task of communicating science to the public. Within the scientific community there is still often a stigma associated with being involved in the media. Such attitudes are not appropriate. Given the importance of public understanding of science and the extent to which scientists must be democratically accountable to those who support their training and research through public taxation, it is clearly a part of each scientist’s professional responsibility to promote the public understanding of science.» 26Jede Doktorandin und jeder Doktorand, hält der «Bodmer Report» fest, müsse die wesentlichen Punkte ihrer respektive seiner Arbeit einem breiten Publikum erklären können. Dieser Punkt ist hervorzuheben: Der Bericht kommt zwar zum Schluss, dass alle wissenschaftlichen Institutionen gute PR-Organisationen haben sollten, nimmt jedoch den einzelnen Wissenschaftler in die Pflicht. Die Aufgabe der Wissenschaftskommunikation obliegt ihm. Authentisch erklärt er der Öffentlichkeit, was Sache ist.
DIALOG, PARTIZIPATION UND CITIZEN SCIENCE
Das Konzept des Public Understanding of Science, das von der Royal Society entworfen wurde, prägte mit seiner elitären Haltung die frühe Wissenschaftskommunikation: Wissende erklärten Unwissenden die Welt. Davon hat sich die Wissenschaftskommunikation im neuen Jahrtausend verabschiedet. Die Schweizer Stiftung Science et Cité (SeC) setzte schon 1998, im Jahr ihrer Gründung, auf den Dialog, ihr deutsches Pendant, die 1999 ins Leben gerufene Organisation Wissenschaft im Dialog, trägt diesen sogar im Namen, und die Unesco propagierte ebenfalls noch im alten Jahrhundert die «Science for all»: Wissenschaft stehe nicht nur im Dienst aller, sondern könne durch alle realisiert werden.
Heute ist nicht nur vom gleichberechtigten Dialog und von Partizipation die Rede, sondern auch von Citizen Science, also von bürgergestützter Wissenschaft. Der Begriff ist 1996 von einem US-amerikanischen Ornithologen geprägt worden. Er bezeichnet seither die von Forschungsinstitutionen gestarteten Initiativen, die Laiinnen und Laien miteinbeziehen, indem sie sie ermuntern, Daten zu sammeln, die der Forschung zugutekommen – Vögel und Pflanzen zu zählen, das Verhalten des eigenen Körpers aufzuzeichnen, Fotos zu datieren. Das haben die Mitglieder der naturforschenden Gesellschaften im 19. Jahrhundert auch schon gemacht. Citizen Science wird in mehreren Disziplinen meist über Webplattformen praktiziert: in Biologie, in Umweltwissenschaften, in Astrophysik, im Gesundheitswesen, in Geografie, aber auch in Geschichte und Archivwissenschaften. Wenn Forschungsinstitutionen Citizen Science betreiben, werden sie dabei von ihrer Wissenschaftskommunikation unterstützt. Für diese ist die Bürgerwissenschaft ein geeignetes Vehikel, um ihre Ziele zu erreichen, also mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten und diese davon zu überzeugen, dass die Wissenschaften sinnvoll seien.
Doch Citizen Science ist nicht unproblematisch, wie auch der Dialog und die Partizipation es nicht sind: Die Begriffe unterstellen, dass Wissenschaft und Forschung offene Unterfangen sind, zu denen alle etwas zu sagen haben und an denen alle mitmachen können, wenn sie denn wollen. Natürlich kann ich als Bürger den Archäologen fragen – falls ich ihn irgendwo antreffe –, welchen Nutzen seine Forschung habe, und natürlich kann ich der Teilchenphysikerin zu verstehen geben, dass ich das Cern, die Europäische Organisation für Kernforschung, zu teuer fände. Beide werden versuchen, mich vom Sinn ihres Tuns zu überzeugen und von der hohen Relevanz ihrer Erkenntnisse. Diesen Wortwechsel einen Dialog auf Augenhöhe zu nennen, wäre indes reichlich übertrieben. Genauso übertrieben ist es, einen älteren Mann, der die auf einer Luftaufnahme abgebildete unbekannte Ortschaft bestimmen kann, weil er dort aufgewachsen ist und sich an ein markantes Gebäude erinnert, das nicht mehr steht, einen Wissenschaftler zu nennen, auch wenn seine Angabe für das Archiv, das im Besitz des Bildes ist, hilfreich ist und vielleicht sogar eine Doktorandin der Geschichte weiterbringt. Das Sammeln von Daten gehört zur Wissenschaft, aber nicht zum Kern der Forschung. Citizen Science entspricht mehr der Wunschvorstellung der Forschungsinstitutionen als dem tatsächlichen Engagement von Nichtwissenschaftlern im Forschungsfeld, zumal die Sammeltätigkeiten selten zu wissenschaftlichen Publikationen führen. In ihrer soziometrischen Twitter- und LinkedIn-Analyse kommt die Sozialwissenschaftlerin Elise Tancoigne von der Universität Genf zum Schluss, dass die Mehrheit der Personen, die von Citizen Science reden, selbst Wissenschaftlerinnen sind. Citizen Science wird vor allem von Frauen propagiert, die sich als «Citizen-Science-Koordinatorinnen» bezeichnen, und bedeutet in diesem Rahmen meist das Sammeln von Daten für den Umweltschutz. 27
Читать дальше