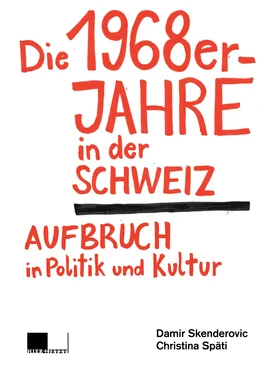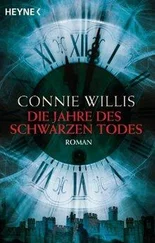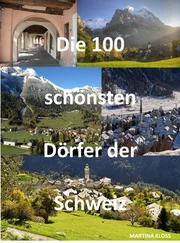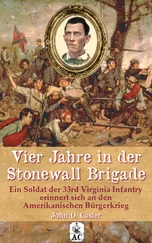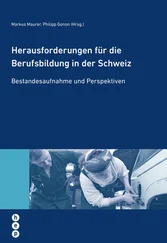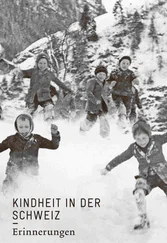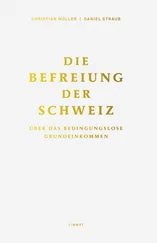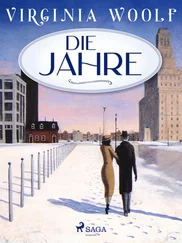Die skeptische bis feindliche Stimmung in der Schweizer Presse vermag jedoch nicht zu verhindern, dass die Pop- und Rockmusik bei der jungen Generation ihren Siegeszug antritt. So hören in der Westschweiz Jugendliche scharenweise die Sendungen der französischen Radiostation Europe nº 1, lesen die 1962 in Frankreich lancierte Zeitschrift «Salut les copains» und verehren Johnny Hallyday, Sylvie Vartan und Eddy Mitchell als Rockidole. Auch unter Deutschschweizer Jugendlichen erfreut sich Europe nº 1, eine der ersten Radiostationen Europas, die Musikprogramme für Jugendliche sendet, grosser Beliebtheit. Wie eine Umfrage von 1967 zeigt, hören 70 Prozent der 17- bis 19-Jährigen den französischen Sender am häufigsten, während es beim Deutschschweizer Sender Beromünster nur gerade 38 Prozent sind. Während sich in der ganzen Schweiz Dutzende von Rockbands formieren und mit ihren Verstärkern und elektrischen Gitarren lauten Sound machen, ist es vor allem in der französischen Schweiz, wo unter dem Begriff «musique Yé-Yé» die Rockmusik einen regelrechten Boom erlebt. 1962 und 1963 finden in Renens die beiden ersten Rockfestivals unter dem Namen «Coupe Suisse de Rock» statt. Als 1962 Johnny Hallyday ein Konzert in Biel gibt, zeigt sich die Presse entsetzt über die Sachschäden, die von Konzertbesuchern verursacht wurden.
Um 1963 und 1964 wird auch die Schweiz von der «Beatlemania» erfasst, und als im Juni 1964 die vier Pilzköpfe aus Liverpool auf ihrem Flug nach Hongkong in Zürich-Kloten zwischenlanden, finden sich nicht nur kreischende Fans auf der Flughafenterrasse, sondern auch die bekannteste einheimische Beat-Band Les Sauterelles, die vergeblich auf ein marketingträchtiges Treffen mit den Superstars wartet. Mitte der 1960er-Jahre entsteht neben Basel vor allem in Zürich mit seinen rund 20 Lokalen, in denen Beat-Bands auftreten können, ein Mekka der Beat-Musik in der Schweiz. 1966 lanciert Jürg Marquard, der spätere Medienunternehmer und Multimillionär, die Zeitschrift «Pop», in der, wie er in der ersten Ausgabe schreibt, «wir Jungen wirklich unter uns sind», und mit der man es den Erwachsenen zeigen wolle, denn sie «haben uns ausgelacht, als wir die Idee für dieses Heft vorbrachten». An Konzerten kommt es immer wieder zu kleineren Scharmützeln mit der Polizei, was die Presse zum Anlass nimmt, eindringlich vor der Gewaltbereitschaft der Jugendlichen zu warnen und von den Behörden resolutes Vorgehen zu verlangen.
Nonkonformisten
Aber auch in anderen Kreisen der schweizerischen Gesellschaft äussert sich seit Mitte der 1950er-Jahre Unzufriedenheit über die Kluft zwischen althergebrachten Werten und den veränderten Lebensformen, zwischen Tradition und Moderne. Auch sie verdeutlichen, dass die 1950er- und 1960er-Jahre eine Umbruchsphase darstellen und dass einzelne Ereignisse und Auseinandersetzungen lange vor 1968 den kritischen Geist von «1968» ankündigen. Zum Kreis der Einzelgänger gehört Kurt Fahrner, der mit seiner Performance-Kunst Öffentlichkeit und Behörden in Basel in Aufruhr versetzt. Im April 1959 stellt er an der Basler «Klagemauer» sein Gemälde «Bild einer gekreuzigten Frau unserer Zeit» aus und verliest dabei sein Manifest «Der grosse Verrat», in dem er die konformistischen Haltungen in der Gesellschaft anprangert. Die Behörden reagieren äusserst heftig, beschlagnahmen Fahrners Bild, das bis 1980 konfisziert bleibt, und verurteilen ihn wegen unzüchtiger Veröffentlichung und Störung der Glaubens- und Religionsfreiheit.
Zu einem breiteren Kreis der kritischen Geister der damaligen Zeit gehören die sogenannten Nonkonformisten, ein Begriff, den ursprünglich rechtsbürgerliche Kreise despektierlich für eine Reihe von Journalisten, Autoren und Intellektuellen verwenden, die sich in ihrem öffentlichen Engagement kritisch mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen. Sie sind aber keineswegs «junge Wilde», die für radikale Visionen einer Schweiz kämpfen oder in ihren literarischen und künstlerischen Ausdrucksformen grundlegend neue Wege zu beschreiten versuchen. Zwischen 1920 und 1930 geboren, walten Nonkonformisten als eine Scharniergeneration zu den «68ern». Mit ihrem konsequenten Auftreten auf der öffentlichen Bühne gelingt es ihnen, Einspruch in der von Kompromissen geprägten schweizerischen Gesellschaft und Politik zu erheben und an der Konformität und Selbstgenügsamkeit der Nachkriegsschweiz zu kratzen.
Zur nonkonformistischen Kritik gesellen sich auch etablierte liberale Intellektuelle, die vom «Unbehagen im Kleinstaat» (Karl Schmid 1963) und der «helvetischen Malaise» (Max Imboden 1964) sprechen und damit auf grundlegende Spannungen in der schweizerischen Politik und Gesellschaft hinweisen. Doch im Gegensatz zur späteren Kritik der «68er», die sich vom «Sonderfall Schweiz» zu lösen sucht, sind sie überzeugt, dass sich Deutungen und Lösungen im nationalen Rahmen finden lassen und die notwendigen Reformen durchaus auf helvetischen Werten und Traditionen beruhen sollen.
Einen Ausgangspunkt für die nonkonformistische Strömung bildet die 1955 veröffentlichte Broschüre «achtung: die Schweiz» von Max Frisch, Lucius Burckhardt und Markus Kutter. Darin prangern die Autoren die raum- und städteplanerische Konzeptlosigkeit der Schweiz an und deuten sie als Zeichen des vorherrschenden Immobilismus. Als Antwort schlagen sie für die Landesausstellung von 1964 in Lausanne den Bau einer Musterstadt im Grünen vor. Das Projekt wird nicht realisiert, obwohl einige der an der Expo 64 gezeigten Kunstwerke und Bauten durchaus einen Hauch von Avantgarde und Moderne versprühen. Im Grossen und Ganzen vermittelt die Ausstellung jedoch ein folkloristisches, rückwärtsgewandtes Selbstbild der Schweiz, gepaart mit dem Fortschrittsglauben der Hochkonjunktur. Daher verfassen einige Autoren aus dem Kreis der Nonkonformisten die Streitschrift «Expo 64 – Trugbild der Schweiz», in der sie an der Ausstellung das bewusste Ausklammern wichtiger Zukunftsfragen und die Unterdrückung von Auseinandersetzungen kritisieren.
In den folgenden Jahren fahren einige Autoren damit fort, in gesellschaftspolitischen Debatten zu intervenieren und Kritik an den eingespielten Argumentationsweisen zu üben. 1965 publiziert Max Frisch seinen berühmt gewordenen Text zur sogenannten Fremdarbeiterfrage, 1967 stellt Alfred A. Häsler in «Das Boot ist voll» die unmenschliche Flüchtlingspolitik der Schweizer Behörden während des Zweiten Weltkriegs an den Pranger. In der Westschweiz wird das «feuilleton littéraire», die Wochenendbeilage der «Gazette de Lausanne», zu einem publizistischen Forum, wo eine Reihe von Autoren wie Franck Jotterand und André Kuenzi kritisch über gesellschaftspolitische und kulturelle Themen schreiben. Es entsteht ein Art Pendant zur nonkonformistischen Strömung in der Deutschschweiz.
Die 1960er-Jahre bilden auch einen fruchtbaren Boden für Neugründungen von Zeitschriften. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang die «neutralität», die der 24-jährige Student Paul Ignaz Vogel 1963 aus Unzufriedenheit über das «erstarrte geistige und politische Klima» in der Schweiz gründet. Die ersten Nummern redigiert er vom Küchentisch in der elterlichen Wohnung aus. Die Zeitschrift trifft offensichtlich zumindest bei den Autoren einen Nerv. Schon in der zweiten Ausgabe schreiben Arnold Künzli und Hansjörg Schneider, im dritten Heft gesellen sich Heinrich Böll und Konrad Farner dazu. Bei den Abonnenten bringt indessen erst das Erstarken des Nonkonformismus im Winter 1964/65 einen Wendepunkt. Bis 1967 erreicht die Zeitschrift eine Auflage von 1000 Exemplaren.
Auch das schweizerische Filmschaffen gerät allmählich in Bewegung und kündigt – wie Martin Schaub in seiner Geschichte des Schweizer Films schreibt – den Bruch von «1968» früher an als anderswo. Anfang der 1960er-Jahre ist das einheimische Filmschaffen noch weitgehend durch kleinbürgerliche und bäuerliche Themen und melodramatische Inszenierungen geprägt. Das Aufkommen einer jüngeren Generation von Filmemachern läutet die Phase des Neuen Schweizer Films ein. An der Expo 64 zeigt Henry Brandt unter dem Titel «La Suisse s’interroge» fünf Kurzfilme zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen wie Immigration, Umweltproblemen, Konsumgesellschaft und Wohnungsnot und grenzt sich ab von zwei mit viel Aufwand produzierten Filmen: der erste eine touristische Landschaftsschau der Schweiz, der zweite ein geräuschvoller Armeefilm. Im gleichen Jahr erscheint Alexander J. Seilers «Siamo Italiani», ein eindrücklicher, kreativ mit filmischen Mitteln arbeitender Dokumentarstreifen zur italienischen Immigration in die Schweiz. 1966 findet die erste Ausgabe der Solothurner Filmtage statt, die in den nächsten Jahren zum Treffpunkt des Schweizer Filmschaffens werden. In der Westschweiz streben eine Reihe von Filmemachern wie Alain Tanner, Claude Goretta, Francis Reusser und Yves Yersin nach einem Aufbruch, was später als Nouveau cinéma suisse bezeichnet wird. Insbesondere Alain Tanner, der Ende der 1950er-Jahre im Umfeld des britischen New Cinema Erfahrungen sammelt und zusammen mit Claude Goretta den Experimentalfilm «Nice Time» (1957) dreht, entwickelt sich auch zum international renommierten Repräsentanten des anderen Schweizer Films.
Читать дальше