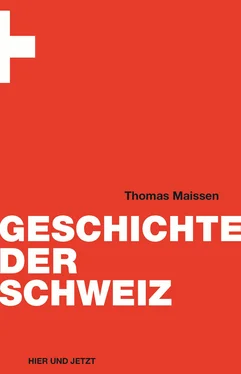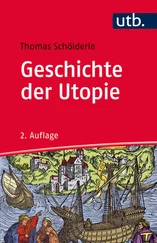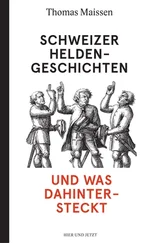Thomas Maissen - Geschichte der Schweiz
Здесь есть возможность читать онлайн «Thomas Maissen - Geschichte der Schweiz» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Geschichte der Schweiz
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Geschichte der Schweiz: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Geschichte der Schweiz»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Geschichte der Schweiz — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Geschichte der Schweiz», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
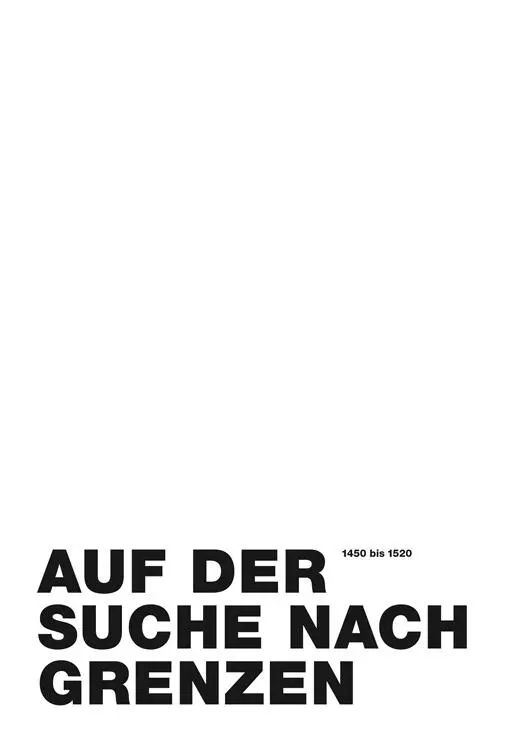
Das weitere Ausgreifen der Eidgenossen in Richtung Bodensee lag angesichts der genannten Verträge mit nördlichen Zugewandten nahe. Es wurde, wie schon im Fall des Aargaus, durch den Konflikt eines Habsburgers mit einer Universalgewalt ermöglicht. Papst Pius II. versetzte Herzog Sigmund von Tirol, den Sohn des 1415 geächteten Friedrich IV., in den Kirchenbann, weil Sigmund einen Dauerstreit mit dem Bischof von Brixen ausfocht, dem berühmten Nikolaus von Kues. Als Teilnehmer des Basler Konzils kannte Pius II. – der bedeutende Humanist Enea Silvio Piccolomini – die Verhältnisse aus eigener Anschauung; in Werken wie De Europa (1458) hatte er das Konzil, aber auch Geografie und Geschichte der Gegend beschrieben und so den abendländischen Gelehrten vorgestellt. Pius lud die Eidgenossen 1460 ein, Sigmunds Gebiete zu besetzen, und schon bald war der Thurgau ebenfalls eine Gemeine Herrschaft unter einem eidgenössischen Landvogt. Dieser Vorstoss richtete sich auch gegen das linksrheinische Konstanz, das im Thurgau zwar vorerst das Landgericht behielt, nun aber Pläne zur Territoriumsbildung begraben musste. Hauptopfer auch der weiteren Entwicklung in der Nordostschweiz blieb aber Österreich. Einige der 1460 eroberten Vogteien um Walenstadt gingen in die 1483 gebildete Gemeine Herrschaft Sargans ein. Rapperswil, bislang gleichsam ein Vorposten im Feindesland, wurde gezwungen, sich von Habsburg loszusagen und 1464 ein Schirmbündnis mit Uri, Schwyz, Unterwalden und Glarus einzugehen, das diesen das Besatzungsrecht für Stadt und Burg zugestand. Nachdem Zürich 1467 die völlig isolierte habsburgische Stadt Winterthur gekauft hatte, verblieb Österreich links des Rheins nur noch das Fricktal mit den Städten Rheinfelden und Laufenburg, woran sich bis 1802 auch nichts mehr ändern sollte.
Die Burgunderkriege
Die Auseinandersetzung mit Habsburg war auch Ausgangspunkt der Burgunderkriege, mit denen die Eidgenossen eher unerwartet auf die europäische Bühne traten. Wie die vorangegangenen Expeditionen in den Bodenseeraum zeugte der Sundgauerzug von 1468 noch eher von (durch Bern) notdürftig kanalisierter Rauflust und Beutegier der eidgenössischen Kriegerhaufen. Sie wollten sich mit dem vorderösterreichischen Adel messen und durch die Belagerung von Waldshut ein beträchtliches Lösegeld erpressen. Herzog Sigmund sah sich nach dem Verlust des Thurgaus erneut bedroht und suchte einen Verbündeten und Geldgeber, den er in Karl dem Kühnen fand. Die Herzöge von Burgund waren eine Seitenlinie der in Frankreich herrschenden Valois, hatten aber ein eigenes Herrschaftsgebiet zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich aufgebaut. Vor allem dank den wohlhabenden Städten in Flandern konnte Karl der Kühne eine eigenständige Grossmachtpolitik verfolgen und gar an ein eigenes Königreich in der Tradition des einstigen lotharingischen Mittelreichs denken. In diese territoriale Politik passten der Sundgau im Elsass und weitere vorderösterreichische Besitzungen, die Sigmund 1469 Karl dem Kühnen für seine Hilfszusage verpfändete. Damit rückte das Herzogtum Burgund in die unmittelbare Nähe der Eidgenossenschaft. Bern sah seine Einflusssphäre bedroht, änderte seine ursprünglich proburgundische Politik und tat sich mit den Reichsstädten am Oberrhein (Basel, Strassburg, Mülhausen) zusammen. Ihre Selbstständigkeit schien durch den neuen Landvogt der Pfandlande, Peter von Hagenbach, bedroht. Er versuchte unter Missachtung der herkömmlichen Autonomierechte die fürstliche Herrschaft auszubauen, wie die Burgunder das in Flandern schon getan hatten. Es gelang den elsässischen Reichsstädten, ihn gefangen zu nehmen, zu verurteilen und hinzurichten.
Dennoch griff Karl der Kühne, am Niederrhein gebunden, nicht persönlich ein. Die fortgesetzte Zurückhaltung gegenüber den Eidgenossen enttäuschte Sigmund, der sich deshalb 1474 zu einem Vertrag mit den Eidgenossen bereitfand, den Karls Gegenspieler vermittelte: der französische König Ludwig XI. Diese – nachträglich so benannte – «Ewige Richtung» beendete die jahrzehntelange Feindschaft zwischen Vorderösterreich/Tirol und der Eidgenossenschaft und bestätigte den Besitzstand, also die habsburgischen Verluste; allein Archivbestände wurden dem Herzog zurückgegeben. Für künftige Konfliktfälle wurden Schiedsrichter bestimmt, der Vertrag sollte für Sigmunds Erben gelten und alle zehn Jahre neu beschworen werden. Gleichzeitig verbündeten sich die Eidgenossen und, in einem eigenen Vertrag, Sigmund mit den oberrheinischen Reichsstädten Colmar und Schlettstadt sowie jeweils Bischof und Stadt von Strassburg und Basel. Während aber die anderen Orte sich nicht weiter in diesen Konflikt hineinziehen lassen wollten, gewann in Bern die Kriegspartei um den neuadligen Niklaus von Diesbach gegen den altadligen, burgunderfreundlichen Adrian von Bubenberg die Oberhand und betrieb nun eigenmächtig Expansionspolitik. In Absprache mit Frankreich, nicht aber mit den Eidgenossen eroberten die Berner zusammen mit Freiburg 1475 weite Teile des Waadtlands von Savoyen, das mit Burgund alliiert war, aber schon länger an inneren Krisen litt. Gleichzeitig verlor Savoyen auch das französischsprachige Unterwallis an die deutschsprachigen Walliser Zenden, die daraus eine Gemeine Herrschaft machten. Erst jetzt reagierte Karl der Kühne selbst militärisch, doch unterschätzten er und sein Ritterheer die nicht standesgleichen Gegner. Die Eidgenossen kamen den Bernern nun doch zu Hilfe. Der Herzog verlor zuerst in der Schlacht bei Grandson seine gesamte kostbare Habe, die «Burgunderbeute». Im Juni 1476 zerschlugen die Schweizer mit vorderösterreichischer und lothringischer Hilfe Karls Söldnerheer in der Schlacht bei der belagerten Stadt Murten. Bei Nancy verlor Karl Anfang 1477 nicht nur die Schlacht, sondern auch sein Leben gegen den Herzog von Lothringen und die Eidgenossen.
Mit diesen Niederlagen zerfiel das burgundische Zwischenreich. Es wurde zwischen Frankreich und Habsburg aufgeteilt, nachdem der künftige Kaiser Maximilian I. die Tochter Karls des Kühnen geheiratet hatte. Damit standen sich die beiden Dynastien Valois und Habsburg in den südlichen Niederlanden und in der Freigrafschaft Burgund, die beide an Maximilian fielen, unmittelbar gegenüber. Ihr Gegensatz wurde zur Ursache für fast alle europäischen Kriege bis ins 18. Jahrhundert. Nutzniesser der Burgunderkriege war also nicht das heterogene eidgenössische Bündnis, von dem Savoyen die verlorenen Gebiete im Waadtland billig zurückerhielt und Frankreich vorübergehend die Freigrafschaft erwarb. Die sieben östlichen Orte wollten sich nicht für die Berner Westexpansion vereinnahmen lassen und bezogen lieber bares Geld. Während die Walliser ihre Eroberungen behielten, musste sich Bern mit Erlach und Aigle begnügen, wozu, in gemeiner Herrschaft mit Freiburg, noch Murten, Echallens, Grandson und Orbe kamen; in der Vogtei Schwarzenburg übten sich die beiden Städte bereits seit 1423 in geteiltem Besitz.
Kriegstüchtigkeit und Beutegier
Wie konnten die schweizerischen Milizsoldaten die ritterlichen burgundischen Berufskrieger besiegen, ja europaweit für einige Jahrzehnte in den Ruf der Unbesiegbarkeit gelangen? Die Voraussetzungen waren nicht ideal: Die einzelnen Orte führten ihre Truppen mit oft unterschiedlichen strategischen Zielen in den Kampf. Die Disziplin dieser nichtadligen Soldaten war ungleich kleiner als ihre Brutalität, Zerstörungswut und Beutegier, was auch daran lag, dass sie gleichsam auf eigene Rechnung kämpften und von den Obrigkeiten nur bedingt logistische Unterstützung erwarten konnten. Das Mannschaftsrecht verpflichtete die Haushalte nicht nur dazu, Krieger zu stellen, sondern sie auch auszurüsten und zu verköstigen. Gemeinden oder Zünfte kontrollierten die Zahl der Wehrpflichtigen und deren Ausrüstung, wenn auch oft eher nachlässig. Mit dem Aufkommen der Feuerwaffen entstanden seit dem späten 14. Jahrhundert eigene Zeughäuser. Hakenbüchsen waren oft zu teuer für einzelne Bürger, und eine Aufbewahrung in anderen Gebäuden, etwa im Rathaus, war wegen der explosiven Munition zu gefährlich. Auch erbeutete Fahnen und Waffen fanden den Weg ins Zeughaus.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Geschichte der Schweiz»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Geschichte der Schweiz» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Geschichte der Schweiz» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.