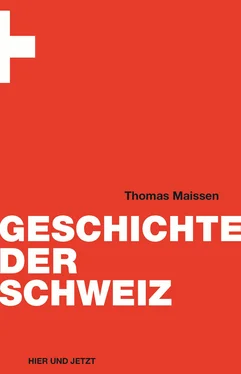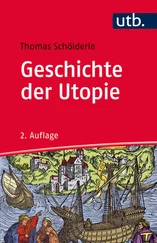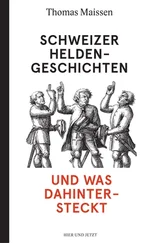Thomas Maissen - Geschichte der Schweiz
Здесь есть возможность читать онлайн «Thomas Maissen - Geschichte der Schweiz» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Geschichte der Schweiz
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Geschichte der Schweiz: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Geschichte der Schweiz»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Geschichte der Schweiz — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Geschichte der Schweiz», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Entgegen der Zürcher Leseweise der älteren Bundesbriefe wurde jedoch die dort vorbehaltene Bündnisfreiheit eingeschränkt, sodass Zürich seine Allianz mit Österreich auflösen musste. Diese Verbindung wurde als Verstoss gegen die eidgenössischen Pflichten interpretiert, weil inzwischen Habsburg in der Argumentation der Innerschweizer zu einem historischen Erbfeind stilisiert wurde, gegen den bereits die Bündnisse des 14. Jahrhunderts gerichtet gewesen seien. Diese hatten indes ganz unterschiedliche, zeitbedingte Ziele und vor allem kein langfristiges Gesamtkonzept verfolgt, sondern gegenseitige Kontrolle und Absicherung der Herrschaftsinteressen gegen innen und aussen. Das konnte grundsätzlich ebenso gut mit wie gegen Habsburg geschehen. Die Zürcher hatten Ersteres versucht, und das machte sie im Innerschweizer Rückblick zu abtrünnigen Verrätern, die einen «Bürgerkrieg» provoziert hatten – ein Bild, das im künftigen Geschichtsverständnis der Schweizer haften blieb.
1450: vom offenen zum ausschliesslichen Bündnis
Tatsächlich musste die Reichsstadt Zürich zwischen zwei problematischen, aber legitimen Optionen wählen, die ihrer Schaukelstellung seit dem 14. Jahrhundert entsprachen: hier die Eidgenossen um die aggressiven Landleute von Schwyz, dort die auf Revanche bedachten Habsburger, die als adlige, ja königliche Fürsten die natürliche Ordnungsmacht in diesem Reichsgebiet gewesen wären. Folgerichtig drängten jetzt gerade die Schwyzer darauf, dass die Landfriedensbünde des 14. Jahrhunderts eine neuartige, exklusive Verbindlichkeit erhielten, welche die acht Orte am 24. August 1450 in Einsiedeln durch einen gemeinsamen Eid erneuerten. Zudem wurden der Luzerner-, Zürcher- und Zugerbund unter dem ursprünglichen Datum neu ausgestellt – nun aber ohne den Vorbehalt der österreichischen Rechte. Die Originalverträge, in denen er festgehalten war, wurden jetzt vernichtet. Die Glarner mussten noch bis 1473 warten, ehe ein ebenfalls zurückdatierter Bundesbrief die nicht sehr freundeidgenössischen Bestimmungen des «bösen Bunds» von 1352 hinfällig machte.
Mit dem Frieden von 1450 trat die Eidgenossenschaft «in einen neuen Aggregatzustand», aus einem lockeren Bündnisgeflecht wurde ein geschlossener «Bündnisverbund» (Bernhard Stettler). Dies war für das politische Überleben der Eidgenossenschaft unabdingbar in einer Zeit, in der die lockeren Städtebünde gegenüber den erstarkenden Fürstenstaaten rasch an Bedeutung verloren. Wie offen die Situation war, zeigte die Fehleinschätzung der Stadt Bremgarten, die auf der Seite Zürichs und Habsburgs kämpfte und 1443 angeboten bekam, sich als eigener Ort der Eidgenossenschaft anzuschliessen, anstatt belagert (und schliesslich erobert) zu werden. Die Bremgarter lehnten ab, weil sie dachten, «die eydgnosschafft wurde kein bestand haben, und wann si ein ort weren, so möchten si nachmalen desterbas [umso eher] wider vom seyl fallen». Hätten die Bremgarter recht behalten, hätten Zürich, Bern und Luzern sich mit anderen Reichsstädten zurechtfinden und möglicherweise ihr Territorium weiter ausdehnen können, etwa zulasten der Landorte. Von denen wurde dagegen allein Schwyz an den Reichstag eingeladen. Es konnte aber ebenso wenig wie die anderen Landorte erwarten, dass die revanchistischen Habsburger, die fortan fast durchgehend den Kaiser stellen sollten, seine Herrschaftsrechte schützen würden. Doch seit 1450 waren diese in den alt-neuen Bünden mit den Städten fest begründet. Das bundesgemässe Recht der Eidgenossenschaft setzte sich durch, das auf Verhandlungen und Schiedsgerichten fusste und den Innerschweizern mehr Einfluss versprach als die gelehrte, römischrechtliche Jurisprudenz im Reich, die den Zürcher Kaufleuten wohl eher entsprach.
Der Bodenseeraum rückt näher
Insofern war es kein Zufall, wenn die Zürcher – mit ihren Handelsinteressen im Reich – sich lange geweigert hatten, «den puren zuo willen» zu sein. Mit der erzwungenen Entscheidung von 1450 wurden sie nun aber zu «Sviceri», ja zu «Kuhschweizern», statt in der schwäbischen Reichsstädtelandschaft zu verbleiben. Solche neu vom wichtigsten Landort auf alle Eidgenossen kollektiv übertragenen Namen standen auch am Ursprung des «Plappartkriegs» von 1458. Nachdem ein Konstanzer Bürger eine Berner Münze als «Kuhplappart» bezeichnet hatte, plünderten Innerschweizer Freischaren das Umland und erpressten von der Stadt 3000 Gulden an Brandschatzung. Wo, wie im Spätmittelalter, kein staatliches Gewaltmonopol Rechtsprechung und Rechtsvollzug gewährleistete, dort diente auch bei Nichtadligen eine Ehrverletzung als Rechtfertigung für eigenmächtige Gewalt, gleichsam in Notwehr als Selbsthilfe, um das eigene Recht zu verteidigen. Da das Fehderecht in der Theorie ein Privileg des Adels war, machte umgekehrt die Fehdepraxis eine Streitpartei tendenziell mit diesem gleichrangig. Wer seine Ehre selbst, also mit Waffengewalt, verteidigen konnte, durfte Gewalt ausüben, wurde also nicht nur fehde-, sondern auch herrschafts- und damit ordnungsfähig. Dies gestand man gemeinhin auch Städten zu. Seit den Appenzellerkriegen nahmen aber nun eidgenössische «Bauern» diese Rolle zusehends im Bodenseeraum wahr, einerseits zugunsten ihrer Bürger und Untertanen, gerade der Kaufleute, andererseits für eine wachsende Zahl von schutzbedürftigen Verbündeten. Dazu gehörten auch fürstliche Herren wie der Abt von St. Gallen, den seit 1437 ein Landrecht an Schwyz band und seit 1451 das ewige Burg- und Landrecht an die Schirmorte Zürich, Luzern, Schwyz und Glarus. Überrascht meinte ein St. Galler Dichter über den Fürstabt: «Er ist ain aidgnoss worden, wer hett das kumb [eben noch] erdacht.» Als der Abt 1468 die Grafschaft Toggenburg erwarb, verblieb diese im 1436 geschlossenen Landrecht mit Schwyz und Glarus, die ihre Freiheitsrechte beschützten.
All dies und die ab 1440 belegte Kategorie der «zu uns gewandten» Orte bewiesen, dass die durch den Frieden von 1450 im Inneren gefestigte Eidgenossenschaft in einem erweiterten Raum zur Ordnungsmacht wurde. Ähnlich sah es im Westen aus, wo sich Freiburg aus den habsburgischen Banden löste, an Savoyen überging und 1454 das Burgrecht mit Bern erneuerte. Es folgten eidgenössische Bündnisse mit fünf nördlichen Reichsstädten, die räumlich von den Orten zum Teil deutlich getrennt, ihnen aber über Handelsbeziehungen verbunden waren: 1454 von sechs Orten (ohne Uri und Unterwalden) mit Schaffhausen und St. Gallen, 1459 von Zürich und Schaffhausen mit Stein am Rhein, 1463 von allen Orten mit dem schwäbischen Rottweil und 1466 von Bern und Solothurn mit dem elsässischen Mülhausen. Auch wenn die zugewandten Städte durch diese Verträge nicht in den Kern der Eidgenossenschaft eingeschlossen wurden, den die Eroberer des Aargaus bildeten, so erlangten damit die Interessen der städtischen Kaufleute im erweiterten schweizerischen Bundesnetz doch ein stärkeres Gewicht. Das sollte bis zum Stanser Verkommnis zu wachsenden Spannungen mit den Landorten führen.
Die Zunftstadt Schaffhausen profitierte vor allem von ihrer Lage am Kreuzpunkt des west-östlichen Verkehrs auf dem Rhein und der Strasse von Zürich Richtung Schwaben, an der auch Rottweil lag. Mülhausen war ein wichtiger Handelsplatz für Elsässer Getreidelieferungen. Die Gewerbestadt Freiburg führte überregional Wolltücher und Lederwaren aus. St. Gallen war gar bis ins 18. Jahrhundert ein europäisches Zentrum der Leinwandproduktion. Wie in Freiburg und generell in Gewerbestädten war die Textilverarbeitung zünftisch organisiert und kontrolliert, während der Fernhandel mit den Endprodukten bei eigenen Kompanien lag. Die in St. Gallen und Bern sowie Nürnberg beheimatete Diesbach-Watt-Handelsgesellschaft unterhielt ein von Spanien bis Polen reichendes europäisches Netzwerk, das neben Textilien alle möglichen Waren und Finanzdienstleistungen vermittelte. St. Gallens Annäherung an die Eidgenossenschaft erfolgte allerdings zu einem Zeitpunkt, als die Diesbach-Watt-Gesellschaft in die Krise geriet, wofür sie nicht zuletzt die Kriegsaktionen der Eidgenossen in der Ostschweiz verantwortlich machte. Nicht europäische Kaufmannsinteressen, sondern zünftische Statuswahrung durch regionale Befriedung und möglichen Herrschaftserwerb war also die St. Galler Perspektive, während die Diesbach in das Berner Patriziat einheirateten und so der Übergang von einer Kaufmanns- zu einer Magistratenfamilie gelang.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Geschichte der Schweiz»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Geschichte der Schweiz» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Geschichte der Schweiz» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.