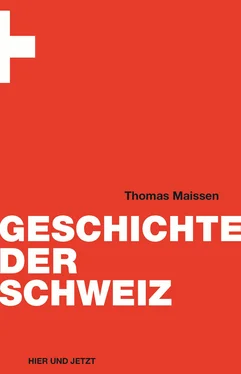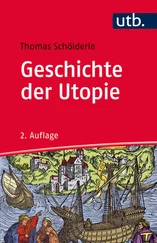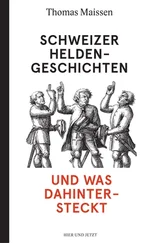Thomas Maissen - Geschichte der Schweiz
Здесь есть возможность читать онлайн «Thomas Maissen - Geschichte der Schweiz» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Geschichte der Schweiz
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Geschichte der Schweiz: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Geschichte der Schweiz»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Geschichte der Schweiz — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Geschichte der Schweiz», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Wie erfolgte die städtische Expansion? Neben dem Pfahlbürger- und Burgrecht diente dazu der Ankauf von zumeist adligen Rechtstiteln und Pfandschaften, anfangs durch stadtsässige Adelsgeschlechter, später auch durch Bürgerliche und durch den städtischen Rat selbst. Immer wichtiger wurde die Abhängigkeit der Bauern von Krediten, die sie in der Stadt erhielten. Kriegerische Eroberungen, wie sie 1415 Bern in grossem, Zürich und Luzern in kleinem Umfang tätigten, waren eher die Ausnahme. Doch der Burgenbruch, im 15. Jahrhundert erleichtert durch die aufkommende Artillerie, war durchaus ein Mittel der Städte, um adlige Bastionen zu zerstören. Wie für den Aargau geschildert, wurden auch im eigenen Territorium die herkömmlichen und vielfältigen Privilegien und Autonomierechte der Landstädte und Dörfer weitgehend geduldet, sodass sich die Stadt ihre obrigkeitlichen Kompetenzen mit den jeweiligen Kommunen, Gerichtsherren oder oft auch geistlichen Institutionen (Klöstern, Stiften) teilen musste, was regelmässig zu Reibungen führte. Soweit die Stadt nicht einfach die bestehenden Vogteien – also in der Regel die bewährte habsburgische Verwaltungseinteilung – übernahm, richtete sie auf ihrem Gebiet neue ein: Die stadtnahen Vogteien wurden direkt von mächtigen Ratsmitgliedern verwaltet, die entfernteren von Landvögten. Sie residierten auf einem Schloss und trieben die hohen Kosten für den Erwerb des Amtes wieder ein, indem sie ihren Anteil an Abgaben wie Zehnten, Steuern oder Zöllen einbehielten und die Güter bewirtschafteten, die ihnen zur Nutzniessung überlassen wurden.
Als einzige und nicht unbedingt sesshafte Stadtbürger in einem manchmal grossen Gebiet waren die Vögte darauf angewiesen, mit den dörflichen Führungsgruppen zusammenzuarbeiten. Grossbauern, Müller oder Wirte stellten die Amtsträger, gewählt zum Teil von der Gemeinde selbst (Säckelmeister, Geschworene) oder vom städtischen Rat, aber meist auf Vorschlag des Dorfes (Ammann, Meier, Weibel, Untervogt). Entsprechend standen sie wiederholt zwischen den Fronten, aber auch an der Spitze von Protestbewegungen von Untertanen, die sich meist zuerst friedlich, durch Beschwerden, gegen obrigkeitliche Willkür oder Forderungen wehrten (Steuern, Kriegsdienst). Auch wenn Widerstand gewalttätig wurde, verteidigten Bauern bloss das Herkommen oder versuchten, das «alte Recht» wiederherzustellen. Das zielte manchmal auf vermehrte Mitsprache, aber nicht auf Umsturz der gesellschaftlichen oder politischen Verhältnisse. Die Veränderungsdynamik ging vielmehr von der Territorienbildung der Städte aus, die ein unmittelbares und strenges Regime führten, wenn man es mit den Habsburgern vergleicht, die mit ihren weit gestreuten Interessen jeweils viele Bereiche der lokalen Selbstverwaltung überliessen. Daher waren ländliche Unruhen im 15. Jahrhundert und bis in die Reformationszeit hinein ein verbreitetes Phänomen: in Zürich der Grüningerhandel (1441) und der Wädenswilerhandel (1467/68), der Böse Bund im Berner Oberland (1445-1451), der Luzerner Amstaldenhandel (1478). Verbrüderungen mit städtischen Bürgern oder Unterschichten ergaben sich fast nie, doch konnten die Landleute wiederholt auf Verständnis und Rückhalt in den Landorten zählen. Nicht selten wirkten diese deshalb im Sinn der eidgenössischen Bünde als für beide Seiten vertrauenerweckende Vermittler und Schiedsrichter, die sowohl den obrigkeitlichen Herrschaftsanspruch als auch das ländliche Gewohnheitsrecht achteten.
Auf solche Vermittlung war Bern bei seiner Ausdehnung gegen Westen nicht angewiesen. Die Expansion erfolgte aber seit dem Laupenkrieg zumeist im Einvernehmen mit Savoyen. Schon davor, 1322, geriet mit dem Erwerb von Thun das Berner Oberland ins Visier. Das Bündnis mit Obwalden sicherte die Grenzen am Brünig, wodurch auch reichsfreie Gebiete (Hasli, Frutigen) in Berner Hand gelangten. Der Burgdorferkrieg von 1384 öffnete den Weg nach Norden, während Gugler- und Sempacherkrieg dazu führten, dass Österreich und Freiburg ihre Stellungen im Seeland und Oberland räumten; 1403 fiel Saanen an Bern. Mit der Eroberung des Aargaus besass er bis 1798 das grösste städtische Territorium nördlich der Alpen. Im Unterschied dazu kam Luzern, das seit 1415 überall an eidgenössische Orte grenzte, nicht mehr über das Gebiet hinaus, das es nach dem Sieg von Sempach in kurzer Zeit erlangt hatte und das bis heute den Kanton bildet.
Dem Ausbau des Zürcher Territoriums stand im Westen und Osten lange das mächtige Habsburg entgegen, im Süden das selbstbewusste Schwyz. Doch auch der innenpolitische Machtgewinn der Handwerkerzünfte prägte die Expansion: Im Unterschied zu den bis ins 14. Jahrhundert dominierenden Kaufleuten, die wichtige Handelswege möglichst weithin kontrollieren wollten, trachteten sie danach, in einem kompakten Hinterland Rohstoffe und Nahrung zu erwerben und dort ihre gewerblichen Produkte abzusetzen. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts gelangten erst einige stadtnahe Gebiete vor allem am See an Zürich, im frühen 15. Jahrhundert dann das heutige Zürcher Oberland und im Westen Regensberg und das Knonauer Amt. Der entscheidende Schritt erfolgte 1424: Mit der Übernahme der Grafschaft Kyburg verdoppelte sich das Zürcher Territorium. Sie hatte früher dem gleichnamigen Grafengeschlecht und dann den Habsburgern gehört, die sie aber nach der Ächtung Friedrichs IV. von Tirol den Zürchern als Reichspfand aushändigen mussten. Dass sich die Habsburger mit diesem weiteren Verlust nicht abfanden, sollte sich schon bald weisen.
Der Alte Zürichkrieg
Mit dem Tod Friedrichs VII., des Grafen von Toggenburg, erlosch 1436 eines der letzten hochadligen Geschlechter auf Schweizer Gebiet. Er hinterliess Besitzungen, die sich südlich des Bodensees im Rheintal und zwischen dem Zürichsee und Davos befanden. Für Zürich war dies die zentrale Verkehrsachse zu den Bündner Pässen und damit nach Süden. Für Schwyz dagegen bildete dieses Gebiet die Brücke zu den verbündeten, sozial und kulturell nahestehenden Appenzellern. Wegen dieser strategischen Bedeutung hatten die Schwyzer bereits 1417 Friedrich VII. von Toggenburg in ihr Landrecht aufgenommen, während seine Gemahlin und Universalerbin Elisabeth 1433 Zürcher Ausburgerin wurde. Als Friedrich ohne Kinder und ohne Testament starb, standen sich damit zwei Parteien mit vertretbaren, aber nicht soliden Erbansprüchen gegenüber. Schwierig wurde die Lage Zürichs, als die Ausburgerin Elisabeth auf ihr Erbe verzichtete. Damit gerieten die Gebiete zwischen Zürich- und Walensee (Grafschaft Uznach, Vogtei Windegg/Gaster) an Schwyz und seinen engsten Verbündeten Glarus, die sie fortan als Gemeine Herrschaft verwalteten. Die Zürcher reagierten 1438 mit einer Kornsperre. Da die Innerschweizer Viehzüchter existenziell von Getreidelieferungen abhängig waren, entstand daraus der Alte Zürichkrieg (1440-1450), in dem sich die übrigen Eidgenossen auf die Seite der Schwyzer stellten. Insbesondere wollte Bern verhindern, dass sich Zürich ähnlich erfolgreich in den Alpenraum vorschob wie es selbst.
Allein gelassen, schaute sich Zürich nach ersten Niederlagen und einem erzwungenen Frieden nach neuen Verbündeten um. Die «keiserliche Stadt», wie sie sich seit Sigismunds Privilegien von 1433 nannte, ging dazu den König und späteren Kaiser Friedrich III. an – mit dem aber seit 1440 wieder ein Habsburger im Reich herrschte. Friedrich war interessiert, einerseits als Pfandherr einiger Gebiete des verstorbenen Grafen von Toggenburg; andererseits deshalb, weil er die Habsburger Stammlande zurückgewinnen wollte. Damit und ebenso mit der Rückgabe der Grafschaft Kyburg erklärten sich die Zürcher im Bündnis einverstanden, das sie mit Friedrich im Juni 1442 «ze ewiger zit» schlossen.
Trotz österreichischer Hilfe blieb Zürich in der Defensive. Nachdem es die Vorladung zu einem Schiedsgericht verweigert hatte, das im Bundesvertrag vorgesehen war, verwüsteten die Eidgenossen das Umland. Der Wortführer gegen Schwyz, Bürgermeister Rudolf Stüssi, fiel vor den Toren der Stadt in der Schlacht bei St. Jakob an der Sihl, die Besatzung der Zürcher Festung Greifensee wurde nach der Eroberung hingerichtet. Dieser «Mord von Greifensee» erregte viel Aufsehen, weil bisher ähnliche Bluttaten unter Eidgenossen unterblieben waren. Entlastung ergab sich dank einer anderen «Schlacht von St. Jakob», an der Birs in der Nähe von Basel, wo gleichzeitig (von 1431 bis 1449) das Konzil tagte. An der Birs stellten sich gut tausend Eidgenossen den Armagnaken in den Weg, Söldnern des französischen Thronfolgers, des späteren Ludwig XI. In einer Ruhepause des Hundertjährigen Kriegs zogen sie plündernd gegen das Mittelland, wozu Friedrich III. sie aufgefordert hatte. Die eidgenössischen Truppen wurden zwar völlig aufgerieben, doch verzichtete der Dauphin auf den weiteren Vormarsch. Nachdem König Friedrich III. den Reichskrieg ausgerufen hatte, griff stattdessen sein Bruder, Erzherzog Albrecht VI., der Regent in den Vorlanden, mit südwestdeutschen Adligen zusammen in die Kämpfe ein, die sich nun als Entscheidung zwischen habsburgischer Nobilität und «Schwyzer» Bauern präsentierten. Militärisch blieb es aber beim Patt, bis Bern als unumgänglicher, da mächtiger Vermittler 1450 einen Frieden herbeiführte, der Zürich fast alle besetzten Gebiete ohne Kriegsentschädigung zurückgab. Auch die Landvogtei Kyburg kam als Pfand wieder dauerhaft an die Stadt. Dies war ein Grundzug selbst der bittersten Kriege unter Eidgenossen und sollte es bleiben: Am territorialen Besitzstand der Verlierer wurde im Prinzip nicht gerüttelt, wie der Blick auf die heutigen Kantonsgrenzen lehrt, die zumeist jahrhundertealten Linien folgen. Die Bünde konnten nur dauerhaft werden, wenn sie die gemeinsame Sicherung der einzelörtischen Herrschaft gewährten. Expansion auf Kosten anderer Orte musste diesen Grundkonsens zerstören.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Geschichte der Schweiz»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Geschichte der Schweiz» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Geschichte der Schweiz» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.