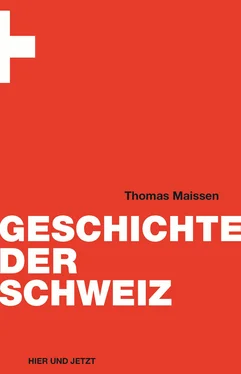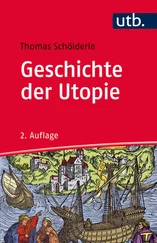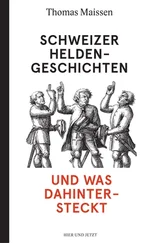1 ...8 9 10 12 13 14 ...20
Zenden und Landsgemeinden
Mit der räumlichen Nähe nahmen auch die Reibungsflächen zwischen den Orten zu, zumal wenn ihre Interessen jenseits der eigenen Grenzen aufeinanderstiessen, wie das, zeitgleich mit der Eroberung des Aargaus, im Walliser Raron-Handel der Fall war. Bern unterstützte den Freiherren von Raron, der die Landeshoheit des Fürstbischofs von Sitten in eine erbliche seiner Familie umwandeln wollte. Luzern, Uri und Unterwalden standen dagegen den Oberwalliser Gemeinden bei. Diese sieben weitgehend autonomen Zenden (Talschaften) mit einem jeweils jährlich gewählten Meier oder Kastlan (Vogt) an der Spitze verteidigten 1420 erfolgreich die Mitspracherechte des Landrats, gleichsam die Walliser Form einer regelmässigen Tagsatzung. Anders als in der Eidgenossenschaft hatte der Landrat aber einerseits im Fürstbischof einen monarchischen Gegenpart und wählte andererseits selbst auch alle zwei Jahre einen Exekutivbeamten, den Landeshauptmann. Mit ihm und der Mitsprache bei Ämtervergaben und politischen Entscheidungen hielten die Zenden nicht nur den Fürstbischof in Schach, sondern bildeten auch einen dichteren politischen Verband als die Eidgenossenschaft.
Wie in Appenzell und Zug zeigte sich im Wallis, dass bei den innereidgenössischen Spannungen neben geografischen Einflusszonen auch politische Ordnungsmodelle umstritten waren. Den stark durch Patrizier geprägten Städten standen in Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarus und Appenzell, auch im Amt Zug sowie in Graubünden und im Wallis ländliche Kommunen gegenüber, deren Bürger ab ihrem 14. oder 16. Altersjahr an der Landsgemeinde vergleichsweise demokratische Mitsprache ausübten, auch wenn sie in Clans mit familiären oder wirtschaftlichen Abhängigkeiten eingebunden blieben und die Vorstellung individueller Bürgerrechte fehlte. Die Landsgemeinden waren ursprünglich Gerichtstage, an denen aber seit dem 14. Jahrhundert anstelle eines obrigkeitlichen Vogts die Vertreter der Täler unter einem Landammann zu Gericht sassen. Das konnte später an eigene Zivil- und Strafgerichte delegiert werden, doch übte etwa im Kanton Nidwalden die Landsgemeinde bis 1850 die hohe Gerichtsbarkeit aus: Die Bürger entschieden also gemeinsam über schwere Verbrechen, gegebenenfalls verhängten sie auch die Todesstrafe. Bei fehlender Gewaltentrennung kamen der Landsgemeinde auch alle anderen politischen Kompetenzen zu: wichtige Wahlen (Landesämter, oberste Gerichte, Gesandte, zahlreiche Beamte), der Erlass neuer Gesetze, die Genehmigung von Entscheiden der eidgenössischen Tagsatzungen. Dazu kamen zahlreiche Verwaltungsgeschäfte: Aussenbeziehungen, Reisläuferei, Steuern und Finanzen, Landrechtserteilungen, die Nutzung der Allmend.
Die Landsgemeinden wurden mit strengem Zeremoniell vollzogen und brachten zum Ausdruck, wem in den Landorten «der höchste Gewalt» zukam: den waffenfähigen, vollberechtigten Landleuten. Diese folgten aber in der Regel den zeitlich und ökonomisch abkömmlichen Häuptern aus den einflussreichen und verdienten Geschlechtern. Doch anders als ein Stadtpatrizier und erst recht ein Fürst wussten die Potentaten nicht nur um die Gefahr, sondern auch um die Legitimität einer Revolte oder eines Strafgerichts (der Bündner «Fähnlilupf», die Walliser «Mazze»), wenn sie den Bogen überspannen sollten: Die Klienten, die von ihren Patronen nicht durch Standesschranken geschieden waren, wollten nicht Steuern bezahlen und feste Entscheidungshierarchien errichten, sondern an Privilegien und Pensionen teilhaben. Insofern ist es kein Zufall, dass «Bauern» – oder vielmehr nichtadlige Landleute – sich sonst nirgends in Europa auf Dauer als Herrschaftsträger etablieren konnten: Wer Entscheidungen immer wieder relativ aufwendig aushandeln musste, konnte nur mühsam staatliche, also auf Gehorsam ausgerichtete Strukturen aufbauen und kaum länger Krieg führen und das Territorium ausweiten.
Reichsfreiheit als Herrschaftskern
Für eine Ausdehnung des Territoriums hatten im eidgenössischen Raum die Städte günstigere Voraussetzungen, zumal sie dank dem Aufschwung des Gewerbes in den Jahrzehnten um 1400 wirtschaftlich prosperierten. Anders als in Deutschland endeten ihre Herrschaftsrechte nicht zumeist, wie selbst in der grössten Reichsstadt Köln, an der Stadtmauer; anders als in Italien wurde aber auch nicht das ganze Land der städtischen Kommune unterworfen, wie etwa der contado von Florenz. Die eidgenössischen Städte blieben auf Partner und damit Kompromisse mit den Landorten angewiesen, die sie nicht beherrschen konnten, die aber – anders als die fürstliche Territorienbildung – auch keine ernsthafte politische Gefahr für die städtische Herrschaft darstellten. Vielmehr stützten sich Stadtorte und Landgemeinden gegenseitig im defensiven Anliegen, die Reichsfreiheit zu verteidigen, die ihnen Sigismunds «Privilegiensegen» von 1415 grosszügig gewährte und die er als Kaiser 1433 bestätigte. Die Eidgenossen konnten ihre Herrschaftsrechte also unmittelbar auf den obersten Richter auf Erden zurückführen, der zumindest dem Anspruch nach die weltliche Universalgewalt darstellte.
Den Kern der mittelalterlichen Herrschaftslegitimation machte denn auch die Gerichtsbarkeit in Stellvertretung des Königs aus, vor allem der Blutbann für die Todesstrafe, den die meisten Orte um 1400 verliehen bekamen; ausserdem der Ausschluss fremder oder höherer Berufungsinstanzen (privilegium de non appellando/evocando) und die niedere Gerichtsbarkeit, die dank Bussen auch Einnahmen abwarf. Dazu kamen die verschiedenen Regalien, konkrete wirtschaftliche und finanzielle Nutzungsrechte, die ursprünglich dem König (rex) vorbehalten gewesen waren: Münzprägung, Zollerhebung, Marktrecht, Salz- und Bergbau, Waldnutzung (Jagdrecht), Fischerei, Mühlen. Der Übergang zu indirekten Steuern war etwa beim Salzmonopol oft fliessend, während direkte Steuern (auf Vermögen) in der Regel befristet und zweckgebunden waren, etwa für Rüstungsmassnahmen. Im selben Zusammenhang erlaubte das Mannschaftsrecht, Soldaten auszuheben – im Prinzip gemäss der allgemeinen Wehrpflicht. Nicht zuletzt im Hinblick auf die Wehr- und Reispflicht war schliesslich das Huldigungsrecht von erheblicher Bedeutung: Bürger und Untertanen hatten ihrem Herren Treue und Gehorsam zu geloben, ohne dass diesbezüglich ein grundsätzlicher Unterschied zwischen fürstlicher, städtischer oder ländlicher Obrigkeit gemacht wurde.
Die Städte bilden Territorien
Für das Mittelalter und generell für die vorstaatliche Zeit war allerdings bezeichnend, dass solche und weitere hoheitliche Rechte keineswegs zwingend in einer Hand vereint und auf einem grösseren Gebiet vereinheitlicht waren. Auf eine solche Landeshoheit und später Staatlichkeit steuerte aber langfristig die Territorienbildung der Städte hin, die angesichts der eher anarchischen Folgen der ländlich-kommunalen Selbstbestimmung – etwa im Fall Appenzells – zusätzlich daran interessiert waren, eine klare Herrschaftsordnung aufzubauen. Die Räte wollten nicht mehr jede Massnahme mit einem konkreten, bestehenden Rechtstitel begründen müssen, sondern aus umfassender Befugnis als «oberste herrschafft» Entscheidungen treffen auch in Bereichen, die bisher noch nicht obrigkeitlich gestaltet waren; und diese Entscheidungen sollten für alle Beherrschten gleichermassen gelten. Sprachlich zeigte sich das darin, dass Zürich herkömmlich aneinanderreihend von «ünser grafschaften, herrschaften, gerichte und gebiet» sprach, seit den 1430er-Jahren aber zusammenfassend von «allen unsern gerichten und gebieten» und schliesslich über «unser ganzes Gebiet». Parallel dazu ersetzte seit der Mitte des 15. Jahrhunderts «Untertanen» das freundlichere «die unsern» oder gar «unsere eydtgnossen». Dieser Sprachgebrauch verriet den etwa für Weggis und Vitznau bereits erwähnten Prozess, dass oft aus wechselseitigen Bündnissen und Schutzbeziehungen Abhängigkeit und, als die (habsburgische) Bedrohung wegfiel, Untertänigkeit wurde.
Читать дальше