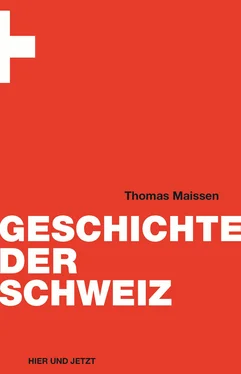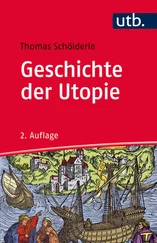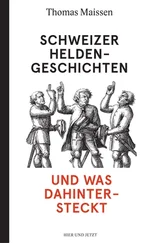Thomas Maissen - Geschichte der Schweiz
Здесь есть возможность читать онлайн «Thomas Maissen - Geschichte der Schweiz» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Geschichte der Schweiz
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Geschichte der Schweiz: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Geschichte der Schweiz»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Geschichte der Schweiz — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Geschichte der Schweiz», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Die Gegensätze unter den Eidgenossen waren damit nicht behoben, wie der «Zuger Handel» von 1404 zeigte. Gegen die Stadt Zug stützte Schwyz das «Äussere Amt», die ländlichen Gemeinden (Baar, Menzingen und Ägeri), die befürchteten, dass die Stadt sie dank dem königlichen Privileg des Blutgerichts unterwerfen würde. Auf ähnliche Weise eigneten sich nämlich die eidgenössischen Städte allmählich ein untertäniges Territorium an, wogegen die bäuerlichen Kommunen Autonomie oder Gleichrangigkeit mit der Stadt zu bewahren suchten. Insofern trat in Zug ein grundsätzlicher Konflikt zutage, in welchem dem wichtigsten Landort Schwyz nicht zufällig die Reichsstadt Zürich entgegentrat, die mit Luzern, Uri und Unterwalden zugunsten der Stadt Zug eingriff. Die in den Bünden vorgesehene Schlichtung wurde nötig, worauf Bern und Solothurn zusammen mit Glarus als Vermittler wirkten und gegen Schwyz entschieden. Es musste die drei Landgemeinden aus dem Landrecht entlassen, mit dem die Schwyzer ähnlich wie die Städte mit dem Burgrecht versucht hatten, ihre Nachbarn an sich zu binden.
Ein Landrecht schloss Schwyz 1403 auch mit Appenzell, das seit den 1360er-Jahren gegen seinen mit Habsburg verbündeten Landesherrn, den Fürstabt von St.Gallen, um seine hergebrachten Rechte und konkrete Abgaben stritt. Nachdem die Appenzeller in der Schlacht am Stoss 1405 sogar ein österreichisches Heer hatten besiegen können, taten sich ähnlich wie in der Eidgenossenschaft Bauern und Bürger in einem «Bund ob dem See» zusammen. Die Stadt St. Gallen sowie weitere ländliche Kommunen und Städte im Rheintal gesellten sich zu Appenzell, sodass sich eine politische Neuordnung zulasten Österreichs und des Adels anbahnte. Doch 1407 konnte der schwäbische Ritterbund Sankt Jörgenschild die seit Monaten belagerte Stadt Bregenz am Bodensee entsetzen und die Appenzeller wenig später schlagen.
Der Bund ob dem See wurde aufgelöst, aber die Appenzeller konnten ihre Unabhängigkeit vom Fürstabt durch ein Burg- und Landrecht mit allen Eidgenossen (ausser Bern) wahren, das ihnen verbot, eigenmächtig Kriege zu eröffnen. Insofern war dieser Vertrag ebenso ein Zähmungsinstrument wie eine Allianz. Dies bewies erneut, dass die kommunale Selbstorganisation auch als ausgreifende Ordnungsmacht eine Alternative zur fürstlichen Territorialherrschaft darstellte: Die Eidgenossen bestätigten nämlich auch die Herrschaftsrechte des St. Galler Abtes. Ritterbünde wie Sankt Jörgenschild, die auf der Fehdehilfe «wider die Geburen zu Appenzell und ihre Helfer» beruhten, vermochten dagegen keine dauerhaften politischen Strukturen aufzubauen. Gegen diesen Adel richtete sich in den Augen der Zeitgenossen die von Schwyz geführte Bewegung, die in Bauernunruhen etwa in Savoyen oder England zeitgleiche Parallelen kannte und in der die eben noch unbekannten Appenzeller zu ansteckendem Ruhm gelangt waren: «Die puren woltent all gern Appenzeller sin.»
Die Gemeinen Herrschaften als verbindendes Element
Im Reich herrschte seit 1410 mit Sigismund letztmals ein Luxemburger König, der 1433 auch Kaiser wurde. Mit Reichsreform, Kirchenreform und Kreuzzug hatte er hohe Ziele. Voraussetzung dafür war ein Ende des Schismas, das der abendländischen Kirche seit 1378 zwei und seit 1409 gar drei Päpste bescherte. Dazu betrieb Sigismund ein Konzil, das 1414-1418 fern von den streitenden Päpsten in der Bischofsstadt Konstanz stattfand, und damit in unmittelbarer Nähe zu den Eidgenossen. Als der (Gegen-)Papst Johannes XXIII. in Konstanz realisierte, dass er nicht in seinem Amt bestätigt, sondern wie seine beiden Konkurrenten zur Abdankung gezwungen werden sollte, floh er zu seinem Beschützer, dem habsburgischen Herzog Friedrich IV. von Tirol. König Sigismund, der um den Erfolg seiner Reformen fürchtete, liess Johannes XXIII. 1415 gefangen nehmen und absetzen, während er Friedrich alle seine Rechte absprach.
Damit war es ein Reichskrieg, in dem die Eidgenossen – ähnlich wie etwa Bayern, die Allgäuer Städte oder der Bischof von Chur – gegen den Herzog marschierten und in königlichem Auftrag in die habsburgischen Stammlande einzogen. Der fünfzigjährige Friede, den sie eben erst, 1412, mit ihm geschlossen hatten, war für den König Makulatur. Sigismund erklärte Luzern, Zug und Glarus für reichsunmittelbar und entband sie damit von der formal noch bestehenden österreichischen Herrschaft. Die Berner rückten zielstrebig von Westen her vor und unterstellten die eroberten Gebiete – den künftigen Berner Aargau – ihrer direkten Herrschaft. Die übrigen Eidgenossen (ohne Uri) griffen eher zögerlich an und fürchteten die Revanche der Habsburger, die besonders Zürich geografisch wie politisch näher lagen. Die Eidgenossen schufen deshalb aus der Grafschaft Baden und den Freien Ämtern im Reuss- und Bünztal «Gemeine Herrschaften» mit einem privilegierten Status für die – zumindest vorübergehend – reichsfreien Städte Baden, Bremgarten und Mellingen. Die Gemeinen Herrschaften kamen unter die gemeinsame Verwaltung von Zürich, Luzern, Schwyz, Unterwalden, Glarus und Zug sowie – nur für die Grafschaft Baden – Bern und ab 1443 auch Uri. Jeder Ort stellte abwechslungsweise für zwei Jahre einen Landvogt. Für die Aargauer änderte sich damit wenig: Anstatt habsburgischen Herren waren sie nun den Eidgenossen unterstellt, welche die Hoheitsrechte in Form einer Reichspfandschaft vom König erwarben. Bestehende Privilegien, etwa bei der niederen Gerichtsbarkeit, wurden respektiert. Damit beschränkte sich die Herrschaft in der Regel auf die höhere Gerichtsbarkeit (Blutgericht, Appellation), das Mannschaftsrecht und einzelne Abgaben (Todfall, Zoll, Bussen). Dazu zählten auch Schutzbriefe für die Juden, welche die Eidgenossen nach ihrem generellen Ausweisungsbeschluss von 1489 allein in der Grafschaft Baden (Surbtal) duldeten.
Wenn die Eroberung des Aargaus ökonomisch wenig ausmachte, so war sie politisch bedeutungsvoll: Die habsburgischen Stammlande wurden von einem trennenden zu einem verbindenden Element der Eidgenossen, auch wenn die Herzöge noch lange nicht bereit waren, den Verlust der Habsburg, der dynastischen Grablege im Kloster Königsfelden oder des Archivs im Verwaltungszentrum Baden anzuerkennen. Erst jetzt wurden sie, für mehr als ein halbes Jahrhundert, zu «Erbfeinden» der Eidgenossen, was diese umgekehrt im Bestreben zusammenschweisste, die Kriegsbeute gegen einen an sich übermächtigen Gegner zu behaupten.
Das Mittelland zwischen Saane und Limmat stellte nun ein von Bern und den übrigen Eidgenossen dominiertes, einigermassen geschlossenes Untertanengebiet dar. Damit entstand aus einem Netzwerk von zerstreuten Herrschaftsträgern – was ja viele Städtebünde gewesen waren – ein eigenständiger, kollektiver Herrscher in einem Raum, der durchaus fürstliche Ausmasse besass und sich im Spannungsfeld der herzoglichen Territorialbildung von Savoyen, Mailand und Habsburg behaupten konnte. Mit den Gemeinen Herrschaften hatten die Eidgenossen auch erstmals eine gemeinsame politische Aufgabe. Die jährliche Rechnungsablage der Landvögte, die jeweils um Pfingsten in Baden stattfand, wurde zum Kerngeschäft der eidgenössischen Tage, der zukünftigen Tagsatzungen, die anfangs allerdings noch an verschiedenen Orten und meistens in Luzern abgehalten wurden.
Vor der Eroberung des Aargaus 1415 hatte es nur sporadisch und an unterschiedlichen Orten Treffen der Verbündeten gegeben. Beschlüsse hatten Einstimmigkeit erfordert; jetzt wurden für die Gemeinen Herrschaften Mehrheitsentscheidungen möglich. Die Eidgenossen zeigten damit, dass sie Strukturen schaffen konnten, die eine fürstliche Schiedsgewalt überflüssig machten. Dazu musste der Informationsaustausch unter den Standeshäuptern verdichtet werden, wozu nicht nur die regelmässigen und formalisierten Treffen beitrugen, sondern auch deren Verschriftlichung in den «Abschieden», den Beschlussprotokollen. Dafür blieben die Kanzleien der einzelnen Orte zuständig. Diese Kanzleien bildeten zugleich den Grundstein einer eigentlichen Verwaltung, mit spezialisierten und gut bezahlten Schreibern, mit Urkundenbüchern, Stadt- und Landsatzungen, Listen von Rechtstiteln, Bürger- und Steuerverzeichnissen und schriftlichen Verordnungen (Mandaten), die das Verhalten von Bürgern und Untertanen regelten.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Geschichte der Schweiz»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Geschichte der Schweiz» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Geschichte der Schweiz» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.