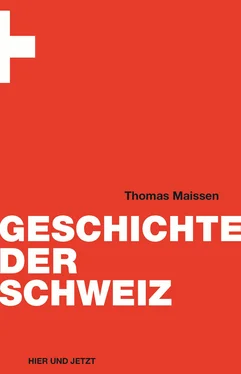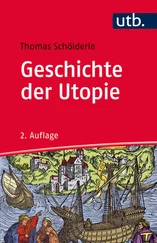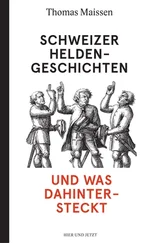Thomas Maissen - Geschichte der Schweiz
Здесь есть возможность читать онлайн «Thomas Maissen - Geschichte der Schweiz» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Geschichte der Schweiz
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Geschichte der Schweiz: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Geschichte der Schweiz»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Geschichte der Schweiz — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Geschichte der Schweiz», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Die «Auswanderung auf Zeit» erfolgte anfangs eher aus Abenteuerlust als aus Not. Das änderte sich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, als einerseits die Bevölkerungszahl sich vom Einbruch durch die Pest wieder erholte und Land wie Arbeit in einer extensiven Viehwirtschaft knapp wurden, andererseits der Alte Zürichkrieg Fernhandel und Gewerbe nachhaltig geschwächt hatte. Vor allem junge, unverheiratete Männer wanderten aus: Söhne ohne Erbe, Knechte und Taglöhner. Für die 40 Jahre von den Burgunderkriegen bis Marignano kommen manche Schätzungen auf insgesamt über 100 000 Söldner, von denen die Hälfte nicht mehr zurückfand – eine beträchtliche Zahl im Verhältnis zu den um 1500 etwa 600 000 bis 800 000 Einwohnern des Landes. Vor allem die Landbevölkerung, die durch die vielen Kriegsdienste lange Abwesenheiten und viele Verluste erdulden musste, zweifelte zusehends, ob sie dafür angemessen entschädigt wurde. Wiederholt, vor allem in der Schlussphase der Mailänderkriege, regte sich Widerstand gegen die vielen opferreichen Truppenaufgebote. Gemeinhin wurden die fremden Dienste als Quelle von Korruption und Dekadenz angesehen, häufig durch die Assoziation mit Prostitution. In literarischen und bildlichen Darstellungen entstand daraus die Gegenüberstellung des alten, tugendhaften und des jungen, im Ausland verdorbenen Eidgenossen.
Der schlechte Ruf, in den die Solddienste schon bei den Zeitgenossen gerieten, ging vor allem auf die Pensionen zurück, welche Fürsten seit den Burgunderkriegen in grossem Massstab und regelmässig zu bezahlen begannen: nicht nur offiziell den Orten selbst, sondern auch heimlich mächtigen Politikern. Durch «Praktizieren», das heisst die Bestechung von Räten oder Landsgemeinden, sollten die genehmen Personen in Ämter gewählt und die gewünschten Entscheidungen gefällt werden, nicht zuletzt der Abschluss von Kapitulationen; aber auch das Wegschauen bei unbewilligten Werbungen. Schon früh versuchte man, allerdings erfolglos, das Pensionenwesen zu kontrollieren. Alle Orte unterschrieben 1503 den Pensionenbrief, der die fremden Dienste auch deshalb der obrigkeitlichen Zustimmung unterstellte, weil das ausufernde Pensionen- und Söldnerwesen in vieler Herren Ländern den Zusammenhalt der Eidgenossenschaft gefährdete. Doch der Pensionenbrief blieb wirkungslos. Allzu viele Geschlechter verdankten ihren politischen Einfluss fremden Zahlungen, mit denen sie ein Klientelnetz unterhalten konnten.
Zu diesen Pensionenherren und Kriegsunternehmern zählte Hans Waldmann in Zürich. Er, ein zugezogener Schneider und Gerber, war nicht der Einzige, der dank militärischem Ruhm (und einer guten Heirat) rasch aufstieg: zum Geldverleiher und Soldunternehmer, sogar zum Bürgermeister. Die eidgenössischen Führungsgruppen wurden bis ins frühe 16. Jahrhundert in Kriegen und fremden Diensten regelmässig dezimiert, womit Zuwanderer vor allem von der Landschaft Aufstiegschancen hatten. Bürgermeister Waldmann stützte sich auf die Zunftmeister und bekämpfte die Patrizier, um die Stellung des städtischen Rats zu stärken. Mit demselben Ziel wurde das bäuerliche Textilgewerbe eingeschränkt und damit das Monopol der städtischen Zünfte unterstützt. Zu offener Empörung führte schliesslich der Befehl, die grossen Hunde der Bauern zu töten, weil sie den Wildbestand schädigten. Solche Massnahmen, mit denen die Obrigkeit das Territorium verstärkt kontrollieren wollte, verstiessen gegen das, was die Landleute als ihr «altes recht und frijhheiten» ansahen. Waldmann wurde gestürzt und hingerichtet.
Nicht nur Bauern, auch verburgrechtete Adlige, bevogtete Klöster und die Einwohner von Kleinstädten spürten den hoheitlichen Zugriff vor allem bei vermehrten Steuern und Kriegsdiensten. Besonders gut sichtbar wurde diese Spannung in der Auseinandersetzung des Berner Rats mit den zumeist kleinadligen Gerichtsherren oder Twingherren um Adrian von Bubenberg, die auf der Landschaft herkömmlich für die lokale Gerichtsbarkeit zuständig waren. «Twing und Bann» meinte Gebieten und Verbieten, nicht zuletzt auch Strafen mit Geldbussen. Für den Berner Twingherrenstreit (1470/71) gab ein Luxusgesetz den Anlass, welches das Tragen von höfisch-modischen Schnabelschuhen verbot. Eigentlich wollte der Rat aber die Kompetenzen der Gerichtsherren beschneiden, indem er Gerichtsfälle oder zumindest Berufungsentscheidungen an sich zog. Kurzfristig scheiterte das Unterfangen, als Peter Kistler zurücktreten musste, mit dem in Bern erstmals ein Nichtadliger Schultheiss geworden war. Doch die langfristige Tendenz ging in der ganzen Schweiz zu einer stärkeren rechtlichen Vereinheitlichung und zur Unterordnung der Landsässigen – Ritteradel ebenso wie Dorfaristokraten – unter die städtische Regierung von Zünftlern oder einem neuen Patriziat.
Krieg zwischen Schweizern und Schwaben
Die Eidgenossen hatten bewiesen, dass sie südlich des Rheins eigenständig als Ordnungsgewalt wirken und, wenn auch zögerlich, auch jenseits des jeweils eigenen Territoriums herrschaftliche Strukturen aufbauen konnten. Das erklärt, weshalb sie am vergleichbaren Vorhaben nicht interessiert waren, das am Reichstag zu Worms 1495 angegangen wurde. Die Schweizer Reichsstände waren dort gar nicht zugegen. Der Reichstag bot der europäischen Mittelmacht, die Karl den Kühnen besiegt hatte, kein angemessenes Gefäss mehr: Die Orte hätten sich auf der schwäbischen Bank der einflussarmen Reichsstädte zurechtfinden müssen. Am Reichstag hatten die Fürsten das Sagen; insbesondere die geistlichen Kurfürsten waren es, welche die Reichsreform voranbrachten. Das Reichskammergericht in Frankfurt (und ab 1527 in Speyer) wurde geschaffen, ein Reichsregiment von Kaiser und Fürsten geplant, die Bildung von Reichskreisen (unter anderem die benachbarten in Schwaben, Österreich und am Oberrhein) angegangen. Sie sollten Urteile des Kammergerichts umsetzen und die Landesverteidigung garantieren, beides wenn nötig mit Waffengewalt. Diese Zentralisierungsmassnahmen bezweckten, den «ewigen Landfrieden» (der tatsächlich bis 1806 Bestand haben sollte) sicherzustellen und das adlige Instrument der Fehde auszumerzen. In der Eidgenossenschaft war beides kein Problem mehr, für das man «nüwerungen» auf sich genommen hätte, insbesondere nicht den Gemeinen Pfennig als Kopf-, Vermögens- und Einkommenssteuer für das Reich. Wie andere periphere Reichsgebiete von Böhmen über Savoyen hin zu den Niederlanden versagten sich die Eidgenossen diesen Reformen. Die Massnahmen gegen das Fehdewesen hätten auch eine Handhabe geliefert gegen die schweizerischen Kriegerhaufen, die das Umland mit ihren Beutezügen und Erpressungen heimsuchten. Während die Reichsstände als treibende Kraft eine «gestaltete Verdichtung» (Peter Moraw) der Reichsstrukturen betrieben, wollten die Eidgenossen gleichsam im «unverdichteten» Reich verbleiben – nicht aber dieses verlassen.
Eher zufällig zur gleichen Zeit brach der Schwaben- oder Schweizerkrieg aus, wie er nach dem jeweiligen Feind benannt wurde. Im Umfeld der Eidgenossen trat mit dem Gotteshausbund nun ein neuer Akteur auf. Das Gotteshaus war das Bistum Chur, dessen Bischof in die landständische Struktur des Bundes eingebunden war, der ausser der Stadt Chur etliche Talschaften umfasste, die vom Domleschg über den Albula und das Engadin in die Seitentäler Bergell, Puschlav und Münstertal reichten. Allianzen mit den Gotteshausleuten hatte im Laufe des 15. Jahrhunderts auch der Obere oder Graue Bund geschlossen, in dem sich seit 1395 der Abt von Disentis, Adlige und Gemeinden des Vorder- und Hinterrheintals zusammenfanden. Um Fehden zu vermeiden und damit den Übergang über die verschiedenen Alpenpässe vom Panixer bis zum San Bernardino für Händler zu sichern, schloss der Graue Bund schon früh verschiedene Bündnisse, insbesondere mit Glarus. 1471 kam es ausserdem zu einer Allianz mit dem dritten und jüngsten der rätischen Bünde, dem 1436 – nach dem Tod des Feudalherrn Friedrich VII. von Toggenburg – gegründeten Zehngerichtebund, der von Davos über das Prättigau bis nach Maienfeld reichte. Hier erlangte in den 1470er-Jahren Herzog Sigmund von Tirol das Blutgericht, das ein lokaler Landvogt von der Burg Castels aus wahrnahm. Zugleich bildete der Zehngerichtebund mit dem Grauen und dem Gotteshausbund aber einen selbstständigen Teil des übergreifenden Zusammenschlusses als «Drei Bünde». Sie verpflichteten sich zu Hilfeleistungen und Schiedsgerichten und vereinten regelmässig die Gesandten der rund 50 Talschaften zu Bundstagen, nicht zuletzt im Hinblick auf eine eigene Aussenpolitik. Angesichts der habsburgischen Präsenz in der Region lag es nahe, dass der Graue Bund und der Gotteshausbund 1497/98 eine Allianz mit den Eidgenossen (ohne Bern) eingingen. Kurz darauf eskalierte ein Streit um Vogteirechte im Münstertal zwischen dem Gotteshausbund und dem habsburgischen Landesherrn von Tirol. Dies war nun aber nicht mehr der 1490 verstorbene Sigmund, sondern Maximilian, der Erbe des Burgunderreichs und seit 1493 König im Reich. Die epochalen Kriege von Habsburg gegen Valois wurden seit 1494 in Italien geführt, wohin der französische König vorgestossen war. Entsprechend wichtig waren für Maximilian die Bündner Passwege nach Italien. Anders als sein Vater, Kaiser Friedrich III., pflegte er zu den Eidgenossen zumeist guten Kontakt. Doch im Konflikt mit dem Gotteshausbund rief er den schwäbischen Bund zu Hilfe, der 1488 gleichsam als Nachfolgeorganisation des Sankt Jörgenschildes gegründet worden war. Diesem gehörte Maximilian selbst an, ausserdem der Herzog von Württemberg, hohe und niedrige Adlige, Prälaten und 20 schwäbische Reichsstädte. Diese Zusammensetzung zeigt, dass sich nun zwei widersprüchliche Bündnis- und damit Ordnungsmodelle in der Region Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein gegenüberstanden: das adlig-hierarchische, das tendenziell Urteile von akademisch ausgebildeten Juristen am Reichskammergericht umsetzte, und das kommunale von gleichrangigen Orten, die Konflikte durch Schiedsgerichte von Laien oder durch Waffengewalt aushandelten. Dazu kam die militärische und wirtschaftliche Konkurrenz zwischen schwäbischen Landsknechten und schweizerischen Reisläufern, die sich mit dem Ruf «Hie Lanz! – Hie Schwytz!» entgegentraten.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Geschichte der Schweiz»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Geschichte der Schweiz» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Geschichte der Schweiz» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.