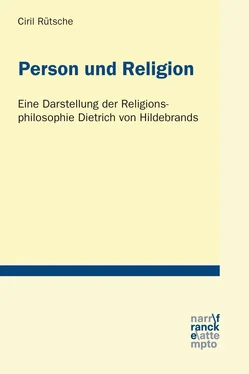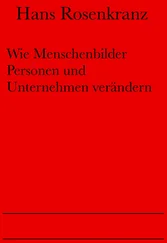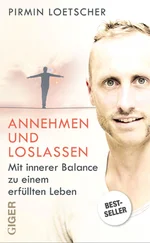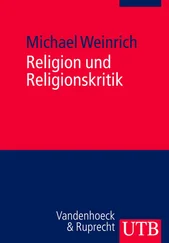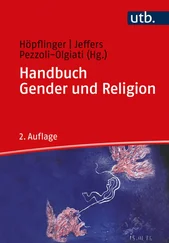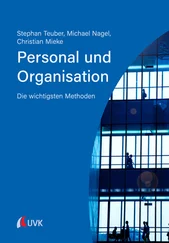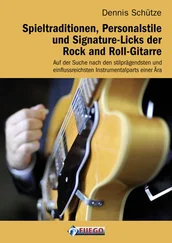6 Was ist „Realistische PhänomenologiePhänomenologie“?
Der im letzten Punkt eingebrachte BegriffBegriff der Realistischen Phänomenologie Phänomenologie bedarf ebenso einer Klärung wie von Hildebrands Schrift Was ist Philosophie? einer Offenlegung des intendierten Ziels und der Mittel, mit dessen Hilfe das ZielZiel erreicht werden soll. Der Begriff der Realistischen Phänomenologie wird in diesem, von Hildebrands Was ist Philosophie? im nächsten Punkt thematisiert werden. Bei der Besprechung der epistemologischen Hauptschrift von Hildebrands bleibt abschliessend zu prüfen, ob, und wenn ja, inwiefern er das gesteckte Ziel auch tatsächlich erreicht hat.
Die Verwendung des Begriffs „PhänomenologiePhänomenologie“ reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück. „Das Adjektiv ‚phänomenologisch‘ taucht nachweislich schon 1762 bei dem schwäbischen Theosophen Friedrich Chr. Oetinger (1701–1782) auf. Als Substantiv wird das WortWort zur selben Zeit von Johann Heinr. Lambert (1728–1777) verwendet.“1 Dem Wortsinn nach (gr. φαινόμενον – ErscheinungErscheinung; λόγος – Wort, Lehre) steht „Phänomenologie“ für die Lehre von den Erscheinungen bzw. von den Erfahrungen. Und da die Erfahrungen ihren Ursprung in dem erfahrenden BewusstseinBewusstsein haben, lag es nahe, die Philosophie mit Franz BrentanoBrentanoFranz2 (1838–1917) als deskriptive Psychologie zu definieren.3 Durch die Vermittlung seines Wiener Lehrers BrentanoBrentanoFranz, kam das Verständnis der Philosophie als deskriptiver Psychologie schliesslich auch auf Edmund HusserlHusserlEdmund, der es ohne Vorbehalte übernahm.4
6.1 Die Vorboten des phänomenologischen Realismus
Wenngleich Edmund HusserlHusserlEdmund als Begründer der phänomenologischen Bewegung gilt,1 so dürfen die vorhusserlianischen Wurzeln dieser Bewegung dennoch nicht übersehen werden. Auf dem von PlatonPlaton, AristotelesAristoteles und AugustinusAugustinus gelegten Fundament ist auch Johann Wolfgang von GoetheGoetheJohann Wolfgang von mit seinem Ausdruck „UrphänomenUrphänomen“ zu den Vorläufern der Realistischen PhänomenologiePhänomenologie zu rechnen. In seinen Gesprächen mit Johann Peter Eckermann eröffnet er ihm am 18. Februar 1829 das Verständnis dieses Begriffs:
Das Höchste, wozu der MenschMensch gelangen kann, ist das Erstaunen, und wenn das UrphänomenUrphänomen ihn in Erstaunen setzt, so sei er zufrieden; ein Höheres kann es ihm nicht gewähren, und ein Weiteres soll er nicht dahinter suchen; hier ist die Grenze. Aber den Menschen ist der Anblick eines Urphänomens gewöhnlich nicht genug, sie denken, es müsse noch weiter gehen, und sie sind den Kindern ähnlich, die, wenn sie in einen Spiegel geguckt, ihn sogleich umwenden, um zu sehen, was auf der anderen Seite ist.2
HusserlHusserlEdmund hatte aber auch noch andere bedeutende Vorläufer. So den Prager Philosophen Bernard BolzanoBolzanoBernard3 (1781–1848), dessen logischer Objektivismus einen grossen Einfluss auf Husserls Logische Untersuchungen ausgeübt hat, und vor allem den bereits erwähnten Franz BrentanoBrentanoFranz.4 Noch vor HusserlHusserlEdmund entwickelte auch Max SchelerSchelerMax in seiner 1899 erschienenen Habilitationsschrift Die transzendentale und die psychologische Methode Methode . Eine grundsätzliche Erörterung zur philosophischen Methodik ganz ähnliche Gedanken.5 Mit ihm kommt auch Alexander PfänderPfänderAlexander (1870–1941) mit seiner 1900 erstmals erschienenen Phänomenologie Phänomenologie des Wollens . Motive und Motivation Motivation als gleichzeitiger Mitbegründer der Phänomenologie in Betracht. Nicht zu verschweigen ist auch der Einfluss von Adolf ReinachReinachAdolf (1883–1917), der, obzwar zu der Zeit Husserls Schüler, als eigentlicher Begründer des phänomenologischen Objektivismus angesehen werden muss.6 ReinachReinachAdolf hatte einen grossen Einfluss auf die jüngeren Phänomenologen, zu denen neben Alexandre KoiréKoiréAlexandre (1892–1964) und Edith SteinSteinEdith (1891–1942) u.a. auch Dietrich von HildebrandHildebrandDietrich von gehörte.
Nach der Publikation von Husserls Ideen Ideen zu einer reinen Phänomenologie Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie im Jahre 1913 nahmen verschiedene Phänomenologen allerdings eine kritische Haltung zu Husserls neuen Theorien und seiner Wende zum transzendentalen IdealismusTranszendentaler Idealismus ein. Eine Gruppe von Phänomenologen blieb Husserls Frühwerk und seinen Logischen Untersuchungen verbunden. Nachdem diese Richtung einst als Kreis der Göttinger und Münchener Phänomenologen bezeichnet wurde,7 hatte Josef SeifertSeifertJosef den Terminus Realistische Phänomenologie Realistische Phänomenologie eingeführt, um die historischen Bezeichnungen, die irreführend sein können, und die esoterischen Bezeichnungen Chreontologie und chreontische Philosophie8 mit einem sachlich angemesseneren Ausdruck zu überholen.9 Der phänomenologische Realismus ist nicht eine Philosophie, deren Gegenstände sich aus einer Setzung oder KonstruktionKonstruktion ergeben. Sie versteht die WirklichkeitWirklichkeit vielmehr so, dass ihre Gegenstände sich in ihrer eigenen objektiven NaturNatur und ihrer eigenen idealen oder realen ExistenzExistenz zu erkennen geben. Auch will sie keine neue Schulrichtung sein, sondern auf der „ewigen Philosophie“ ( philosophia perennis ) aufbauen, wie sie bei PlatonPlaton, AristotelesAristoteles, AugustinusAugustinus, AnselmAnselmvon Canterbury von Canterbury, Thomas von AquinThomas von Aquin, René DescartesDescartesRené und bei vielen anderen grundgelegt wurde.10
6.2 Husserls Beiträge zur Beantwortung der „Kardinalfrage der ErkenntnistheorieErkenntnistheorie, die ObjektivitätObjektivität der ErkenntnisErkenntnis betreffend“1
Wenn im Folgenden das WesenWesen und die MethodeMethode der Realistischen PhänomenologiePhänomenologie herauszuarbeiten gesucht wird, dann geschieht dies durch einen kritischen Vergleich mit gewissen Husserlschen Thesen.2 Was die nachmaligen Realistischen Phänomenologen unter Husserls Studenten an seinem Frühwerk begeisterte, war sein konsequenter Objektivismus. Die MaximeMaxime, die ihn in Logische Untersuchungen leitete, lautete: „Wir wollen auf die ‚Sachen selbst‘ zurückgehen“3. Mit dieser Maxime stellte HusserlHusserlEdmund sich entschieden gegen alle subjektivistischen Reduktionismen und alle konstruktiven Tendenzen, welche häufig im IrrtumIrrtum enden.4
Gegen den RelativismusRelativismus in der FormForm des AnthropologismusAnthropologismus, demnach für die Spezies MenschMensch nur das wahr ist, „was nach ihrer Konstitution, nach ihren Denkgesetzen als wahr zu gelten habe“, stellt er die Widersinnigkeit der „Rede von einer WahrheitWahrheit für den oder jenen“.5 „Denn es liegt in ihrem Sinne, dass derselbe Urteilsinhalt (SatzSatz) für den Einen, nämlich für ein SubjektSubjekt der Spezies homo , wahr, für einen Anderen, nämlich für ein Subjekt einer anders konstituierten Spezies, falsch sein kann.“6 Derselbe Wortinhalt kann aber nicht beides zugleich sein, nämlich wahr und falsch. „Die Wahrheit relativistisch auf die Konstitution einer Spezies gründen, […] ist aber widersinnig.“7 Denn wenn die Wahrheit ihre alleinige Quelle in der allgemeinen menschlichen Konstitution hätte, so bestünde keine Wahrheit, wenn keine solche Konstitution bestünde. Die Widersinnigkeit zeigt sich auch an der Behauptung, dass keine Wahrheit besteht, „denn der Satz ‚es besteht keine Wahrheit‘ ist dem Sinne nach gleichwertig mit dem Satze „es besteht die Wahrheit, dass keine Wahrheit besteht‘“8. „Was wahr ist, ist absolut, ist ‚an sich‘ wahr; die Wahrheit ist identisch Eine, ob sie Menschen oder Unmenschen, Engel oder Götter urteilend erfassen.“9
Читать дальше