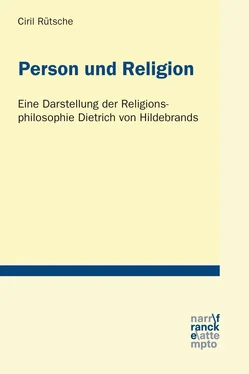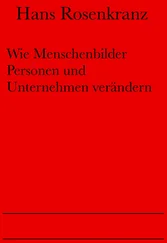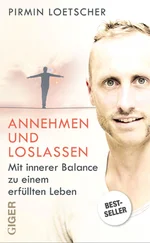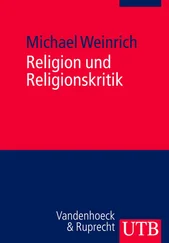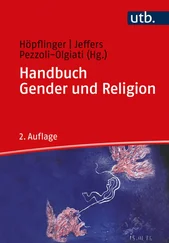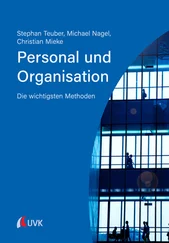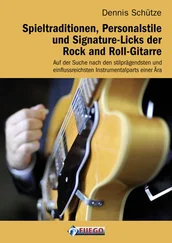Was immer aber der nähere Grund seiner Zurückweisung auch gewesen sein mag, eine sachliche Analyse kommt jedenfalls unweigerlich zum Ergebnis, dass von HildebrandHildebrandDietrich von das Argument Argument implizit bejaht hat und es auch explizit hätte anerkennen müssen, hätte er um die Theorie der reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten und die mit ihr gegebene angemessene BegründungBegründung des ontologischen Arguments gewusst. Implizit hat er es aufgrund dessen bejaht, dass er die sittlichen WerteWerte als die höchsten, die wichtigsten und die zentralsten bezeichnete, die sittlichen Werte aber gerade diejenigen sind, bei denen es sich in vielen Fällen um reine Vollkommenheiten handelt, z.B. bei der GüteGüte, der WahrhaftigkeitWahrhaftigkeit, der GerechtigkeitGerechtigkeit oder der LiebeLiebe, die von HildebrandHildebrandDietrich von selbst GottGott zugeschrieben hat.12 Wie erwähnt, gibt es nebstdem gewisse sittliche Wertesittliche Werte, wie beispielsweise die BescheidenheitBescheidenheit oder die DemutDemut, die die kreatürliche BegrenztheitBegrenztheit und Geschaffenheit des Subjekts voraussetzen, und da sie keine UnendlichkeitUnendlichkeit zulassen, den gemischten Vollkommenheiten zuzurechnen sind.13
Wenngleich der BegriffBegriff des Wertes auch weiter ist und neben den sittlichen noch andere WerteWerte umfasst, so weisen bestimmte sittliche Wertesittliche Werte dennoch die formalen Merkmale göttlicher Eigenschaften auf: Sie sind absolut besser zu sein als nicht zu sein, sie lassen UnendlichkeitUnendlichkeit in einer Weise zu, dass sie nur in der unendlichen FormForm wahrhaft sie selber sind, sie sind gegenseitig verträglich, ja können in einem solchen Sinne alle gleichzeitig besessen werden, dass keine wahrhaft sie selber ist ohne all die anderen und schliesslich können auch die Werte weder von etwas anderem deduziert noch auf anderes reduziert werden. Diese nicht-anthropomorphen Merkmale der reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten in Verbindung mit dem kosmologischen Argument Argument und dem zureichenden Grundzureichender Grund der menschlichen PersonPerson geben GottGott als absolute und vollkommene Person zu erkennen.14 Auch konnte die kritische Anfrage, ob die Werte überhaupt einen SeinsgrundSeinsgrund ausserhalb ihrer selbst benötigen, auf der Basis der intelligiblen Struktur der WirklichkeitWirklichkeit mit verschiedenen Argumenten zurückgewiesen werden, welche letztlich alle darauf hinausliefen, dass die Werte in Gott notwendigerweise ihr letztes Fundament und ihre letzte Wurzel haben.15
Die auf dieser Grundlage erörterten religionskritischen Thesen von FeuerbachFeuerbachLudwig, WittgensteinWittgensteinLudwig und DawkinsDawkinsRichard zeigten ihre Unvernünftigkeit in vielerlei Hinsicht. Während Feuerbach insbesondere an der vermeintlichen Steigerbarkeit der menschlichen Eigenschaften zu unendlicher Perfektion scheiterte,16 litt Wittgensteins gegen die ReligionReligion erhobener Unsinnigkeitsvorwurf allzu stark an der Wende zur Sprache und im Verbund mit einem empiristischen Erfahrungsverständnis mangelte es ihm an einem angemessenen Erkenntniskorrelat, was eine vertiefte Beschäftigung mit den in sprachlichen Sätzen ausformulierten und behaupteten Sachverhalten unterband bzw. von vornherein verunmöglichte.17 Die von DawkinsDawkinsRichard vertretene EvolutionstheorieEvolutionstheorie schliesslich, nach der die Religion wie die menschliche PersonPerson und das gegenwärtig Seiende insgesamt einen bestimmten Stand der additiven Einbahnstrasse evolutiver Höherentwicklung darstelle, konnte als falsch ausgewiesen werden. Und zwar durch das Aufzeigen der Unmöglichkeit, dass das BewusstseinBewusstsein eine Begleiterscheinung des (materiellen) Gehirns ist. Was in erster Linie durch den Aufweis der unzusammengesetzten IndividualitätIndividualität als Bedingung der bewussten geistigen Erfahrungen gelang und in den Wesensanalysen der FreiheitFreiheit ebenso wie des Erkennens seine Bestätigung fand.18
III DER MENSCH UND SEIN ANGELEGTSEIN AUF DIE RELIGION IN DENKEN, FÜHLEN UND WOLLEN
Bei der BegründungBegründung der Vernünftigkeit der ReligionReligion geht es nicht alleine um die Begründung der realen ExistenzExistenz ihres Bezugspunktes, nämlich um die Begründung der notwendigen Existenz Gottes. Die Begründung der Vernünftigkeit der Religion steht und fällt darüber hinaus vor allem mit der Begründung des lebendigen Verhältnisses des Menschen mit GottGott, des „Zwiegesprächs zwischen Geschöpf und Schöpfer“19. Wie aber soll das Bestehen dieses Verhältnisses in vernünftiger Weise nachgewiesen werden? Auch wenn die Existenz Gottes – wie sich gezeigt hat – absolut gewiss ist, wie will man wissen, ob der begrenzte und kontingente MenschMensch überhaupt die Fähigkeit besitzt, um mit der absoluten PersonPerson in ein Verhältnis zu treten? Um diese Frage beantworten zu können, bedarf es im Anschluss an die Beschäftigung mit dem WesenWesen Gottes in erster Linie der Herausarbeitung der zentralen Wesensmerkmale der geistigen Person des Menschen.
1 AugustinusAugustinus, BoethiusBoethius, LockeLockeJohn, die Annäherung an das WesenWesen der PersonPerson1 und die Frage nach der unübersteigbaren VollkommenheitVollkommenheit des Personseins
Ausgehend vom Glauben an die trinitarische Struktur des göttlichen Wesens, den die griechischen Kirchenväter in die Formel μίαν οὐσίαν τρεῖς ὑποστάσεις fassten und im lateinischen Westen durch Tertullians Übersetzung von ὐποστάσεις mit persona in die Formel una substantia, tres personae mündete, sah AugustinusAugustinus sich mit terminologischen Ungereimtheiten konfrontiert. So wisse er nicht, wo der Unterschied liege zwischen οὐσίαν und ὑπόστασιν, da die griechische Formel μίαν οὐσίαν τρεῖς ὑποστάσεις doch eigentlich mit una essentia, tres substantiae zu übersetzen wäre.2 Wenn von drei Personen gesprochen werde, so Augustinus die terminologischen Differenzen resümierend, dann nicht um den SachverhaltSachverhalt angemessen auszudrücken, sondern um nicht zu schweigen.3 Trotz dieser Schwierigkeiten, hob Augustinus den BegriffBegriff der PersonPerson so ins allgemeine BewusstseinBewusstsein, dass der MenschMensch nur in Bezug auf seinen GeistGeist eine Person sei4 und er den Geist als eine Dreieinheit mit einer intentionalen Struktur der Selbst- und Fremdbeziehung definierte. Und nur wenn das Dasein über diese intentionale Struktur verfügt, handelt es sich um eine Person.
Die mit AugustinusAugustinus’ PersonPerson-DefinitionDefinition verbundenen begrifflichen Schwierigkeiten – in Verbindung mit einer christologischen Fragestellung – veranlassten BoethiusBoethius zu einem weiteren Durchdenken des Personbegriffs unter Rückgriff auf die aristotelische Philosophie. Die Ergebnisse seines Bemühens hat er in der kleinen Schrift Contra Euthychen et Nestorium schriftlich fixiert, welcher als V. Traktat der Opuscula sacra eine entscheidende Bedeutung für die mittelalterliche Definition des Personbegriffs zukommt.
Aufgrund der Offensichtlichkeit, dass der PersonPerson die NaturNatur zugrunde liegt und sie nicht ausserhalb von ihr ausgesagt werden kann, geht BoethiusBoethius von den verschiedenen Bedeutungen von Natur ( natura ) aus, welche auf dreierlei Weisen ausgesagt und definiert werden könne. Erstens hätten die Dinge Natur, „die auf gewisse Weise von der VernunftVernunft erfasst werden können, weil sie sind“5; wonach die DefinitionDefinition von Natur sowohl Akzidentien als auch Substanzen beinhaltet. Zweitens sei Natur, „was tätig sein kann oder was erleiden kann“6. Da nach AristotelesAristoteles nur Substanzen das Prinzip der Bewegung sind, definiert Boethius die Natur konsequenterweise als „Prinzip der Bewegung aus sich heraus, nicht beiläufig“7. Drittens bezeichnet natura „die ein jedes Ding bestimmende spezifische Differenz“8.
Читать дальше