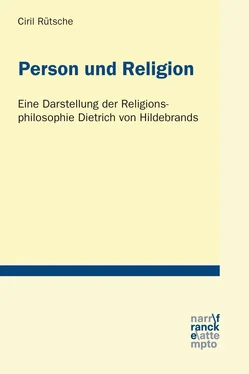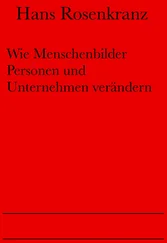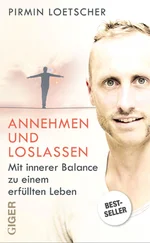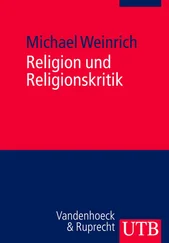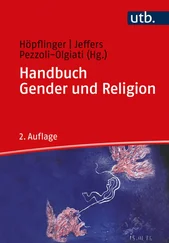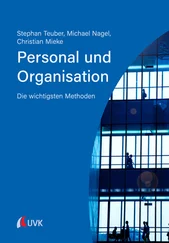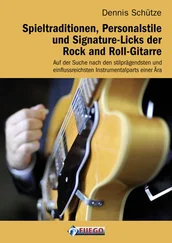Demgegenüber zeichnen sich die psychischen Wirklichkeiten – wie beispielsweise der Schmerz oder der Willensakt – vor allem dadurch aus, dass sie bewusst vollzogen und erlebt werden. Wogegen ein materielles Seiendes unmöglich von innen vollzogen werden kann. Womit auf das nächste Merkmal psychischer Wirklichkeiten verwiesen wurde, auf das SelbstbewusstseinSelbstbewusstsein. Die psychische Erfahrung setzt eine PersonPerson voraus, die sich ihrer selbst bewusst ist, ein Zug, der auf die MaterieMaterie in keiner Weise zutrifft. Sodann lassen sich verschiedene Merkmale des Psychischen unterscheiden, die einerseits nicht in ausnahmslos jedem psychischen Erleben gegenwärtig sein müssen, denen aber keine psychische WirklichkeitWirklichkeit ausnahmslos entbehren kann. Dazu gehören die WachheitWachheitgeistige, die Intensität oder die IntentionalitätIntentionalität, d.h. die bewusste und sinnvolle Beziehung der Person und ihrer Akte auf ein Objekt, von dem sie BewusstseinBewusstsein besitzt.7
5.3.3.2 Argumente gegen die materialistische Reduzierung des Bewusstseins
zu einem Produkt des Gehirns
Wie gesehen, unterscheidet auch der EpiphänomenalismusEpiphänomenalismus zwischen dem Physischen und dem Mentalen. Doch während er annimmt, dass Veränderungen im Physischen geistige Prozesse verursachen, streitet er strikte ab, dass physische Prozesse durch den GeistGeist verursacht werden. Damit spricht er sich nur für die Beziehung aus, die vom Körper zum Geist verläuft, die entgegengesetzte Beziehung vom Geist zum Körper dagegen verbleibt sozusagen inaktuell, ja muss es bleiben, wenn das naturalistische WeltbildWeltbild berücksichtigt wird, das die Grundlage des epiphänomenalistischen Denkens bildet. Demgegenüber sei aufgezeigt, welche Argumente gegen die TheseThese der evolutionär-emergenten Höherentwicklung allen Seins in dem Sinne sprechen, dass das BewusstseinBewusstsein das Produkt des Gehirns sei. Die Unhaltbarkeit jeder Reduzierung des menschlichen Bewusstseins zu einem EpiphänomenEpiphänomen des Gehirns oder auf Vorgänge im Gehirn selber ist auf vielfache Weise demonstrierbar. Dabei ist es nicht entscheidend, ob Bewusstsein nun im Sinne des „frontalen Bewusstseins von“ oder im Sinne des „lateralen“ VollzugsbewusstseinsVollzugsbewusstsein verstanden wird.1 Alles, was nicht zur eigenen PersonPerson gehört, ist in einem „Bewusstsein vonBewusstsein von“ gegeben, als Objekt, das auf der Objektseite erfasst wird. „Wenn ich mich hingegen freue oder begeistere, wenn ich weine oder trauere, liebe oder hasse, liegt kein ‚Bewusstsein von‘ vor, sondern ein bewusst vollzogenes Sein, das mir nicht frontal gegenübersteht.“2 Auch die Gefühle der FreudeFreude oder der Trauer usw. setzen ein „Bewusstsein von“ dem Objekt voraus, das die Freude oder die Trauer motiviert, doch die AntwortenAntworten der Freude oder der Trauer selbst „sind kein ‚Bewusstsein von‘, sondern bewusst Seiende“3. Ebenso ist auch das Sehen nicht so gegeben wie das Gesehene. Denn während man sich bewusst ist, den Akt des Sehens zu vollziehen, wird das Gesehene in einem frontalen „Bewusstsein von“ erfasst. Desgleichen beim Akt des Erkennens, von dem nur dann gesprochen werden kann, wenn ein „Bewusstsein von“ vorliegt. Hat man etwa erkannt, dass nil volitum nisi cogitatum, dann nur deswegen, weil man ein Bewusstsein hat vom Wollen und vom ErkennenErkennen; erkenntnistheoretisch gesprochen, weil man ihr SoseinSosein erfahren hat.4
Dass es absolut unmöglich ist, das menschliche BewusstseinBewusstsein auf eine Begleiterscheinung (EpiphänomenEpiphänomen) des Gehirns oder auf Vorgänge in ihm zu reduzieren, erweist sich am Vergleich des Bewusstseins mit einer beliebigen materiellen SubstanzSubstanz, und das HirnHirn wird von den Materialisten ja gerade als ein materielles Objekt verstanden. Die materielle Substanz selber muss räumlich ausgedehnt, zusammengesetzt, teilbar usw. sein. Werden damit die wesentlichen Merkmale des geistigen Seins verglichen, so die bewusst von innen her vollzogene IntentionalitätIntentionalität, d.h. die bewusste und sinnvolle SubjektSubjekt-Objekt-Beziehung der meisten Erfahrungen, und die NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive, mit der das bewusste Leben die ExistenzExistenz eines bewussten und unteilbaren Subjekts voraussetzt, dessen bewusstes Leben es ist, dann wird die Unmöglichkeit evident, dass eine materielle Substanz in ihrer EinheitEinheit-in-der-Verschiedenheit und ihrer Zusammensetzung die Substanz sein könnte, die die Voraussetzung der bewussten Akte des Subjekts ist.
Dass LeibnizLeibnizGottfried Wilhelm dies deutlich verstanden hat, beweist er mit seiner Vorgabe einer Maschine, „deren Struktur Denken, Empfinden und Perzeptionen haben lässt“, die vergrössert begriffen dergestalt sei, dass man in sie hineintreten könne.5 „Dies gesetzt, würde man beim Besuch im Innern nur einander stossende Teile finden, niemals aber etwas, was eine Perzeption erklärt. So muss man sie in der einfachen SubstanzSubstanz und nicht in dem Zusammengesetzten oder in der Maschine suchen.“6
Die EinfachheitEinfachheit und die unzusammengesetzte IndividualitätIndividualität des Subjekts, das für alle Erfahrungen vorausgesetzt ist, kann nicht eine zusammengesetzte SubstanzSubstanz mit Teilen im Raume sein. Es ist unmittelbar einsichtig, dass materielle, zusammengesetzte Substanzen nie SubjektSubjekt der geistigen Erfahrungen sein können. Wie unbezweifelbar dieses WissenWissen ist, zeigt sich z.B. beim Hören eines musikalischen Werks. Das Hören von Beethovens 9. Symphonie setzt ein unteilbares Subjekt voraus, das in den unzähligen Teilen und zeitlichen Phasen dieser Erfahrung gegenwärtig ist, um überhaupt möglich zu sein. Ein Gehirn mit noch so vielen verschiedenen Teilen und Funktionen könnte nie bewusste Erfahrungen haben. Die 9. Symphonie würde ihr Sein und ihre EinheitEinheit verlieren und total zerstört werden, wenn nicht das eine, identische und unteilbare Selbst das Subjekt wäre, das als das nicht-zusammengesetzte und einfache Ich die erhabenen Klänge dieser Symphonie hören würde. Gleichermassen verhält es sich mit jedem anderen KunstwerkKunstwerk, sei es aus der Architektur, der Skulptur, der Malerei oder der Literatur.7 Mit der Literatur ist auf die Sprache Bezug genommen, für die dasselbe gilt wie für das Hören von Beethovens 9. Symphonie, auch das VerstehenVerstehen einer Sprache setzt ein immaterielles, ein bewusstes Subjekt voraus. Da bewusste menschliche Erfahrungen also eine unteilbare, einfache, nicht-zusammengesetzte Substanz als Subjekt bedingen, keine materielle Substanz aber unteilbar einfach und nicht-zusammengesetzt ist, ist keine materielle Substanz die Substanz, die vorausgesetzt ist als Subjekt für bewusste Erfahrungen des bewussten menschlichen Lebens.
Ein anderes Argument Argument für die immaterielle Seinsweise des menschlichen Geistes und den IrrtumIrrtum des EpiphänomenalismusEpiphänomenalismus hebt an bei der FreiheitFreiheit. Ein Versprechen oder jeder andere freie Akt wäre absurdabsurd, wenn solch ein Akt identisch wäre mit oder determiniert durch materielle oder organische Prozesse. Jeder MenschMensch setzt gewisse freie Akte voraus, auch dann, wenn er den MaterialismusMaterialismus untersucht oder verteidigt. In jedem Moment aber, in dem er die Freiheit voraussetzt, widerspricht er – unbewusst – seiner eigenen Theorie. Wenn eine Handlung vollzogen wird, die die freie Initiative bedingt und nicht die WirkungWirkung einer anderen UrsacheUrsache ist, sondern dem eigenen Selbst entstammt, dann würde diese Handlung überhaupt nicht existieren, wenn sie nicht gewollt worden wäre. So beinhaltet eine solche Handlung die Tatsache, dass das Selbst über ihr Sein und Nichtsein entscheidet. Diese Tatsache widerlegt den Materialismus, nach dem freie Akte nicht existieren können. Das Dasein freier Akte und deren SubjektSubjekt sind irreduzibel auf das Gehirn und jedes andere materielle System.
Читать дальше