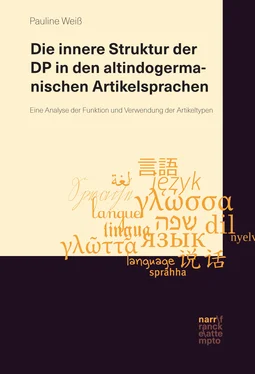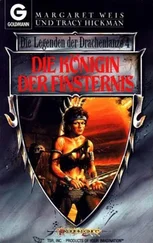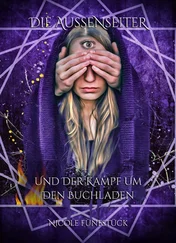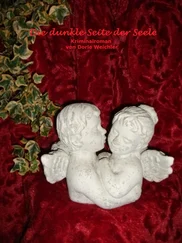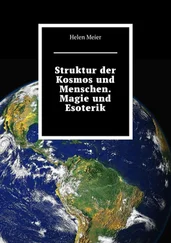Auch die Entfernungsstufen origoinklusiv und origoexklusiv lassen sich auf den altarmenischen Artikel anwenden (vgl. Kap. I.5.2). Arm. -s ist origoinklusiv, während arm. -n Origoexklusivität impliziert. Arm. -d ist ebenfalls als origoexklusiv zu betrachten, da sich der Artikel auf die zweite Person bezieht, die zwar in der Umgebung des Sprechers sein muss, aber trotzdem nicht in direkten Bezug zum Sprecher steht. Zur Untermauerung dieser Klassifikation lässt sich Diewalds (1991) Einordnung der personalen Deiktika dt. ich und du heranziehen. Das Pronomen der ersten Person ist natürlich origoinklusiv, da es auf den Sprecher selbst verweist. Das Deiktikon dt. du klassifiziert Diewald (1991) als origoexklusiv, weil es auf den Hörer referiert, der sich außerhalb der Origo befindet. Eine weitere Unterteilung der personalen Deiktika, die man bei Diewald (1991) findet, ist die Unterscheidung von Person und Nicht-Person. Dabei bezieht sich die Eigenschaft Person auf die Kommunikationsrollen, i.e. Sprecher und Hörer. In diese Kategorie sind arm. -s und -d einzuordnen. Die Kategorie Nicht-Person beschreibt im Gegensatz dazu „… alle durch Nominalphrasen denotierbaren Entitäten …“5, die nicht die Gesprächspartner sind. Diese Rolle erfüllt arm. -n . Die Morpheme arm. -s und -d sind also mit der personalen Dimension verknüpft, da sie stets eine Relation zu einer Person etablieren. Arm. -n hingegen operiert in der objektalen Dimension. Diese ist dadurch gekennzeichnet, dass hier diejenigen Deiktika versammelt sind, die keine Gesprächsrollen denotieren. Vielmehr gehören die Referenten, über die gesprochen wird, in diese Kategorie. Daher ist anzunehmen, dass arm. -n , das sich bekanntermaßen auf die dritte Person bezieht, der objektalen Dimension zugewiesen werden muss, da es auf Elemente referiert, die keine Kommunikationsteilnehmer sind. Als neutraler Artikel referiert es auf Gesprächsgegenstände, Personen, Orte etc.
Dem altarmenischen Artikel ist, wie bereits mehrfach erwähnt, die Funktion Deixis auszudrücken inhärent, so dass er immer weisend wirkt. Er wird gesetzt, um einen Referenten zu markieren und eine Relation zu Sprecher oder Hörer herzustellen. Dadurch, dass er diese doppelte Relation kreiert, ähnelt er stark der oben beschriebenen Funktion der Possessivpronomina, die ebenfalls eine zweifache Relation, zwischen Objekt und Besitzer, darstellen. Daher ist es nicht erstaunlich, dass sich die deiktische Funktion des altarmenischen Artikels im modernen Ostarmenisch zu einer possessiven Funktion entwickelt hat; vgl. z.B. altarm. town-s ‚das Haus‘ vs. ostarm. town-s ‚mein Haus‘.6 Vermutlich konnte der Artikel im Armenischen diese possessive Funktion ausbilden, weil er nicht als Definitheitsmarker notwendig war.
Die armenischen Morpheme arm. -s, -d und -n sind aufgrund ihrer enklitischen Natur abhängige Elemente, aber im Gegensatz zu den Artikeln der anderen Untersuchungssprachen sind sie nicht auf Substantive beschränkt. Stattdessen können sie an Adjektive, Adverbien, Zahlwörter, Verben und sogar Negationen postponiert werden; vgl.
(18) arm. 14.1
| əst |
ōrinaki |
grelocʿ-s |
| gemäß.Präp. |
Beispiel.Subst. |
aufschreiben.Verb-das.Art. |
| + Dat. |
Dat.Sg. |
Prt.nec. |
| ‚gemäß dem Beispiel soll ich das aufschreiben‘ |
Vermutlich übernimmt der Artikel in Beleg (18) die Funktion den Autor zu markieren, da dies keine Personalendung leistet. Die armenischen Morpheme können also eine Erweiterung des Subjekts darstellen.
Der armenische Artikel sorgt also nicht in erster Linie dafür, dass eine Konstituente als definit markiert wird, wie es eigentlich die Hauptaufgabe eines definiten Artikels ist. Aber er spezifiziert Phrasen und setzt sie entweder zu den Gesprächspartnern oder zu einem kürzlich genannten bzw. bereits bekannten Referenten in Beziehung. Das armenische Morphem wirkt demnach identifizierend. So tritt der Artikel an kein Wort, das nicht in irgendeiner Weise als bekannt betrachtet wird, sei es, weil es kurz zuvor erwähnt wurde oder sei es, weil es als bekannt vorausgesetzt werden kann. Oder aber die Aufmerksamkeit des Lesers soll durch die Anfügung des Artikels auf das jeweilige Wort gelenkt werden. Identifizierbarkeit auszudrücken ist erwiesenermaßen nicht die Hauptaufgabe des armenischen Artikels, jedoch beinhaltet seine Verwendung stets einen Hinweis darauf. Lamberterie (1997) schreibt, dass die enklitischen Partikeln ( -s, -d, -n ) eine Relation zwischen Wörtern aufzeigen. Auf der einen Seite stehen die Wörter, die durch den Artikel determiniert sind, und auf der anderen Seite die Personen (entweder die, die spricht ( -s ), die, die angesprochen wird ( -d ), oder die Person bzw. der Gegenstand, der sich außerhalb des Dialogs befindet ( -n )).7
Festzuhalten ist, dass der armenische Artikel fakultativ verwendet wird und dass er bzgl. der semantischen Determination entbehrlich ist. Insgesamt besitzt er vier Funktionen: lokale, deiktische, anaphorische und spezialisierende. In seiner spezialisierenden Funktion steht er dem Typus Artikel, der der Definitheitsmarkierung von Nomina dient, nahe. In seiner anaphorischen Eigenschaft erinnert er an Pronomina. Der lokale und deiktische Charakterzug scheinen einzigartig zu sein.
II. Untersuchung der Belegstellen
In diesem Kapitel werden die Belegstellen geordnet nach den Konstituenten untersucht, i.e. einfache DPn, DPn mit Pronomen, DPn mit Adjektiven etc. Der Fokus liegt dabei stets auf dem Artikel. Die DPn sind so organisiert, dass die Phrasen mit jedem Kapitel komplexer werden. Die einfachen DPn umfassen nur Beispiele mit Artikel und Bezugswort. Anschließend werden substantivierte Elemente besprochen. Diese verhalten sich im Allgemeinen zwar wie Substantive, doch in der syntaktischen Analyse in Kapitel III werden die Differenzen deutlich, da nominalisierte Elemente auf andere Weise generiert werden müssen als Substantive. Im nächsten Punkt werden Konstellationen mit Pronomen erläutert, danach Phrasen mit attributiven Adjektiven usw. Dieses Vorgehen erleichtert den Überblick über alle Belegstellen. Ferner kann durch diese Gliederung untersucht werden, ob spezifizierende Konstituenten die Verwendung des Artikels beeinflussen können.
Die einzelnen Untersuchungssprachen werden zunächst separat analysiert. Die so erzielten Ergebnisse werden in einem Zwischenfazit am Ende jedes Kapitels verglichen. Es wird allerdings nicht jedes Beispiel gesondert erwähnt, vielmehr werden die verschiedenen Phrasentypen vorgestellt und ihre grammatischen Eigenschaften erklärt. Auf Typisches wird hingewiesen und auf Besonderheiten detailliert eingegangen. Von speziellem Interesse sind die Wortstellungsmuster der einzelnen Phrasentypen. Durch den Vergleich der einzelsprachlichen Belegstellen werden allgemeine Serialisierungen herausgearbeitet, die mit abstrakten Bezeichnungen wie „Art“ für Artikel oder „BW“ für Bezugselement operieren.1 Die Wortstellungsmuster entsprechen etwa einem mathematischen Term. Dies dient dazu, dass jedes Serialisierungsphänomen mit Artikel gesondert erklärt werden kann. Durch die Wortstellungsmuster kann man die Positionen der einzelnen Konstituenten innerhalb der Phrase analysieren und feststellen, in welchen Positionen der Artikel auftreten kann. Dies wiederum wird in Kapitel III wichtig sein, um herauszufinden, wo der Artikel innerhalb der DP abgeleitet werden kann. Da der Artikel mit dem Feature Definitheit verknüpft ist, kann dadurch auch eine Position für Definitheit in der DP wahrscheinlich gemacht werden. Wenn eine komplexe Phrase vorliegt und analysiert werden soll, kann man aus den entsprechenden Kapiteln die Einzelkomponenten auswählen und zu einer komplexen Analysestruktur zusammensetzen. Ferner wird anhand der Wortstellungsmuster erklärt, in welcher Relation der Artikel zum Bezugswort steht und ob sich seine Stellung verändert, wenn eine weitere Konstituente wie ein Possessivpronomen, ein Adjektiv etc. hinzukommt. Die abstrahierten Muster sollen die Stellungsmöglichkeiten des Artikels herausstellen und veranschaulichen, welche Positionen eine DP je nach Untersuchungssprache besitzen muss. Zudem hilft es, die Serialisierung im Bezug auf die Artikelsetzung hin zu analysieren, um daraus Regeln zur Verwendung des Artikels ableiten zu können. Der Artikel steht in einer speziellen Relation zur Serialisierung. So sind Calboli (1978 [1979]) und Leiss (2000) der Ansicht, dass der Artikel aus einer Notwendigkeit der Wortstellung heraus entstanden ist. Die Beziehung zwischen Artikel und Satzbau ist mit der referentiellen Kennzeichnung der Nomina verknüpft und die Entwicklung des Artikels evoziert einen Wandel des Satzbaus. So besitzen die alten Sprachstufen des Lateinischen und Griechischen noch keinen Artikel, aber dafür Konstruktionen wie den A.c.I. Nach Calboli (1978 [1979]) begünstigt das Fehlen des Artikels die Akkusativ-mit-Infinitiv-Bildung. Durch den Ausbau der Quantifizierung durch den Artikel werden Konstruktionen wie der A.c.I zurückgedrängt. Des Weiteren gibt es Sprachen, wie das Italienische, in denen auf den definiten Artikel verzichtet werden kann, wenn ein Attribut2 eine Phrase ausreichend als [+definit] markiert.3
Читать дальше