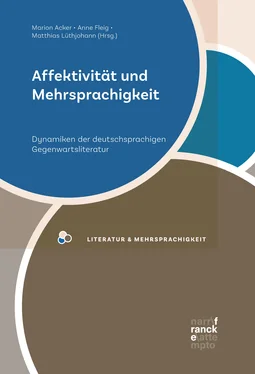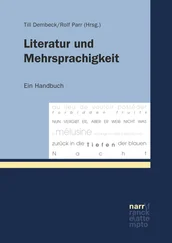Als ein weiterer Schritt in der Formierung des Feldes kann The Affect Theory Reader gelten, der 2010 von Gregory J. SeigworthSeigworth, Gregory J. und Melissa GreggGregg, Melissa herausgegeben wurde und wichtige Vertreterinnen und Vertreter dieser neuen Forschungsrichtung versammelt: Sara AhmedAhmed, Sara, Lauren BerlantBerlant, Lauren, Patricia T. CloughClough, Patricia T., Anna GibbsGibbs, Anna, Lawrence GrossbergGrossberg, Lawrence, Kathleen StewartStewart, Kathleen, Nigel ThriftThrift, Nigel – um nur einige zu nennen. Seigworth und Gregg versuchen in ihrer eher essayistischen Einleitung ihr Anliegen zu formulieren. In Form einer Aufzählung rekapitulieren sie die immense Bandbreite des schillernden Affekt-Begriffs und seiner verschiedenen Bestimmungen als „excess, as autonomous, as impersonal, as the ineffable, as the ongoingness of process, as pedagogic-aesthetic, as virtual, as shareable (mimetic), as sticky, as collective, as contingency, as threshold or conversion point, as immanence of potential (futurity), as the open, as a vibrant incoherence that circulates about zones of cliché and convention, as the gathering place of accumulative dispositions“7. Die Liste verdeutlicht, dass sich unter der Bezeichnung affect studies heterogene Konzepte versammeln, die kein kohärentes Gesamtbild erzeugen. Welches „Versprechen“8, um im emphatischen Duktus des Affect Theory Readers zu bleiben, hält der Affekt-Begriff also für die Literaturwissenschaft bereit?
Autorinnen wie Sara AhmedAhmed, Sara oder Lauren BerlantBerlant, Lauren unterziehen in ihren Studien die Idee des Glücks oder des sogenannten ‚guten Lebens‘ einer kulturwissenschaftlichen Analyse und erhellen ihre Verwobenheit mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen und heteronormativen Strukturen.9 Ann CvetkovichCvetkovich, Ann befasst sich mit Emotionen wie Depression und „feeling bad“ und macht dabei das Politische im vermeintlich Privaten sichtbar.10 Dem transformativen Potenzial affektiver Dissonanz geht das Konzept der „affektiven Solidarität“ ( affective solidarity ) von Clare Hemmings nach.11 Das Konzept des belonging thematisiert die emotionale Dimension von Zugehörigkeiten im Kontext von transkultureller Mobilität und globalen Migrationsprozessen.12 Eine ganze Reihe von Untersuchungen widmet sich der Rolle von Emotionen und Affekten in der Arbeitswelt des gegenwärtigen Kapitalismus: angefangen vom Konzept der affective labour , wie es Michael HardtHardt, Michael und Antonio NegriNegri, Antonio entworfen haben, über Melissa GreggsGregg, Melissa Buch Work’s Intimacy (2011) und die Studie Affektives Kapital (2016) von Otto Penz und Birgit Sauer bis hin zu Rainer Mühlhoffs Dissertationsschrift Immersive Macht (2018).13 Diese Beispiele illustrieren die gesellschaftskritische Reichweite des Affekt-Begriffs und sie zeigen zudem, dass weite Teile der affect studies aus der feministischen Theoriebildung hervorgegangen sind.14 Vor dem Hintergrund der poststrukturalistisch dominierten Debatte um die primär diskursive Konstruktion von Geschlecht bietet der Affektbegriff eine neue Perspektive, die die soziale und historische Bedingtheit von Geschlecht (wieder) mit Fragen nach seiner Materialität und Körperlichkeit verbinden kann. Die von DeleuzeDeleuze, Gilles und MassumiMassumi, Brian geprägte Unterscheidung von unmittelbarem Affekt und diskursiven Emotionen wird in diesem Kontext daher häufig hinterfragt oder gänzlich zurückgewiesen. So unterscheidet Ahmed etwa bewusst nicht zwischen beiden Begriffen, sondern geht im Anschluss an postkoloniale Theorie und Phänomenologie von einem kontinuierlichen Verhältnis aus. Affekt versteht sie als eine Dynamik, die Körper auf bestimmte Weise orientiert und den historischen Macht- und Herrschaftsverhältnissen entsprechend ungleich wirksam ist; stets werden „some bodies more than others“15 affiziert.
Die Schlaglichter auf die neuere Affektforschung verdeutlichen aber auch, dass nur wenige Arbeiten aus dem Bereich der affect studies explizit der Frage sprachlicher bzw. literarischer Affektivität nachgehen. Fokussiert wird vielmehr auf jene Dimensionen des Sozialen, die sich sprachlicher Repräsentation entziehen. Zumindest in ihren Anfängen haben die affect studies Sprache und Affekt als Gegensätze konzeptualisiert und sich damit gegen die dominante Vorstellung der rein diskursiven Konstruktion von Identität und Kultur gewandt. Affekte, so die Behauptung, „do not operate through the structures of language, discourse and meaning“16. Mit ihr ging allerdings eine erhebliche Vereinfachung einher, denn im ‚Jenseits der Sprache’ wurde affect nicht selten zu einem „magical term“17, der aus dem ‚postmodernen Zeichenwald‘ herausführen sollte und – maßgeblich an Gilles DeleuzeDeleuze, Gilles und Félix GuattariGuattari, Félix anschließend – die Produktivität von Intensitäten und forces of encounter betonte. Sprache läuft demgegenüber immer Gefahr, auf ihre zeichenhaften und semantisch bedeutenden Aspekte reduziert zu werden. Die problematische Annahme einer „Sprachunabhängigkeit der Affekte“18, deren historischer Genese Weigel nachgeht, wird damit von den affect studies teilweise selbst fortgeschrieben. Dies gilt auch für den performativ selbstwidersprüchlichen, rhetorischen Topos der Unsagbarkeit: Affektstudien kommunizieren (angeblich) Nicht-Kommunizierbares, versuchen aber im Medium der Sprache, Nicht-, Vor- oder Außersprachliches zu vermitteln.19
Affect Studies und germanistische Emotionsforschung: Für ein Denken in Relationen
Affekttheoretische Ansätze und germanistische Emotionsforschung scheinen vor diesem Hintergrund zunächst schwer vereinbar zu sein: Ein erster Grund hierfür liegt in der Aufmerksamkeit der affect studies für Phänomene jenseits der Reichweite des linguistic turns. Die Betonung der Materialität und Körperlichkeit von Affektivität ist eine Herausforderung, für die die poststrukturalistisch-semiotisch geprägte Germanistik nicht gut ausgerüstet ist.
Ein zweiter Grund resultiert aus der Sprachskepsis seitens der affect studies , deren Entstehung vor dem Hintergrund des Überdrusses an „theories of signification“1 zu sehen ist und damit gewissermaßen selbst affektiv motiviert ist. Dass Sprache relational ist, dass sie auch in ihrer Repräsentationsfunktion affektive Bewegungen vollzieht und in Gestalt von Klang und Schrift2 über eine ihr eigene Materialität und Körperlichkeit verfügt, rückt damit aus dem theoretischen Horizont der Debatte. In diesem Kontext ist auch die Unterscheidung zwischen Affekt und Emotion in den affect studies zu situieren. Auf der einen Seite wird mit dem Affekt die Dynamik, Intensität und Unvorhersehbarkeit des Augenblicks gefasst, der sich der Versprachlichung entzieht. Dem ist die Emotion entgegengesetzt, die eine Überführung dieser Intensität in geregelte, normierte diskursive Bahnen bedeutet. Dass eine solche Konzeptualisierung die Literaturwissenschaft vor methodologische Schwierigkeiten stellt und den Weg zu ihrem sprachlich konstituierten Gegenstand eher verstellt als ebnet, kann kaum verwundern. Es handelt sich um eine wechselseitige Rezeptionssperre, die dazu geführt hat, dass eine größere Auseinandersetzung mit den affect studies in der Germanistik bislang ausgeblieben ist. Die Frage nach dem Verhältnis von Affektivität und Sprache bzw. Mehrsprachigkeit überhaupt zu stellen, bedeutet vor diesem Hintergrund eine zweifache Herausforderung: Weder soll Affektivität als vor-diskursives Geschehen, als ein, wie kritische Stimmen monieren, „homogenisierte[s] Auffanglager für alles Nicht-Sagbare begriffen werden“3, noch ist es wünschenswert, hinter die Einsichten in die kulturelle und soziale Prägung, Codierung und mediale Vermitteltheit von Emotionen und Gefühlen zurückzufallen.
Читать дальше