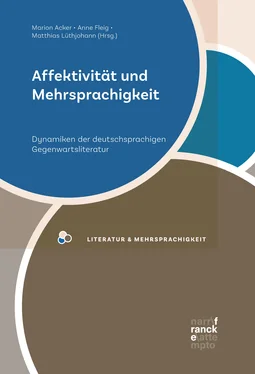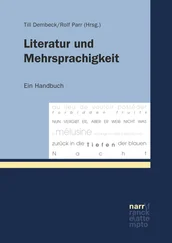2 Die Perspektive der Affektivität
Sprache bringt Gefühle zum Ausdruck und ruft ebensolche hervor. Diese Feststellung ist keineswegs trivial, denn die „mitunter babylonisch anmutende diskursive Vielfalt“1 des historischen Affekt- und Emotionsdenkens stellt die Literaturwissenschaft vor erhebliche Herausforderungen, die die methodische und theoretische Heterogenität ihrer multidisziplinären Forschungsansätze noch verstärkt. Da sich der Emotionsbegriff Martin von Koppenfels und Cornelia Zumbusch zufolge gegenüber dem historisch älteren Begriff des Affekts durchgesetzt hat,2 firmiert das seit den 1990er Jahren (wieder-)erwachte Interesse der Literaturwissenschaft an Gefühlen, ihrer sprachlichen Thematisierung und Präsentation, Produktion und Rezeption, unter dem Schlagwort eines emotional turn .3
Gegenüber den älteren, autorzentrierten Verfahren der hermeneutischen Einfühlung war es Konsens der literaturwissenschaftlichen Theoriebildung im Zeichen von Strukturalismus und Poststrukturalismus, dass sich Gefühle stets vermittelt artikulieren und historisch geprägt sind. So ist die Aufwertung des emotiven Gehalts der Literatur durch diskursanalytische Ansätze allererst ermöglicht worden, indem sie einen intersubjektiv nachvollziehbaren Zugang zu literarischen Konstruktionen von Gefühlen und Emotionen eröffnet haben. Gleichzeitig wurden in der literaturwissenschaftlichen Emotionsforschung zunehmend empirisch orientierte, psychologische und neurowissenschaftliche Ansätze relevant.1 Die wirkungsmächtigen Entwicklungen der neuro- und kognitionswissenschaftlichen Forschungen haben nicht nur in einer ganzen Reihe von Disziplinen, sondern auch in der breiteren Öffentlichkeit zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema der Emotionen beigetragen und eine Infragestellung der Dichotomie von Rationalität und Gefühl unterstützt.2 Als neue Leitdisziplinen der Emotionsforschung haben sie aber auch von verschiedenen Seiten Widerspruch hervorgerufen.3
Sigrid Weigel hat sich mit der „Renaissance der Gefühle in den gegenwärtigen Neurowissenschaften“ befasst und dabei aus kulturwissenschaftlicher Sicht bedenkenswerte Einwände formuliert, die insbesondere der Sprach- und Geschichtsvergessenheit der Neurowissenschaften gelten.4 Die Frage, um was es sich bei der „Entdeckung der Gefühle“ durch die Hirnforschung eigentlich handele, stellt sich ihr geradezu als ein Problem der Mehrsprachigkeit, sprich: „der Termini und ihrer Übersetzungen zwischen verschiedenen Registern (Fachsprachen und Nationalsprachen), als Problem der Begriffs- und Wissenschaftsgeschichte dessen, was dabei mit dem Wort Gefühl benannt wird, aber auch als Frage nach der Rolle der Sprache für die Gefühle, genauer für die Übersetzung psycho-physischer Vorgänge in kulturell codierte und symbolische Bedeutungen, oder anders gesagt, der Schwelle zwischen soma und sema .“5
Aus kulturwissenschaftlicher Perspektive ist der Rekurs auf neurowissenschaftliche Ansätze auch deshalb problematisch, weil damit zumeist die Vorstellung verknüpft ist, Emotionen seien universale, kulturübergreifende, anthropologische Konstanten. Gerade mit Blick auf die mehrsprachige (Gegenwarts-)Literatur ist jedoch deren soziokulturelle Bedingtheit und historische Variabilität hervorzuheben. Exemplarisch für diese kulturwissenschaftliche Perspektive halten Daniela Hammer-Tugendhat und Christina Lutter grundlegend fest: „Emotionen sind immer nur über Sprache und andere Formen kultureller Repräsentationen ausdrückbar und vermittelbar […], wie sie ihrerseits durch Sprache und Repräsentationen (Codes) geformt werden. […] Emotionen sind immer nur näherungsweise bzw. ‚übersetzt‘ zugänglich und können nicht von ihrer kulturell geformten Vermittlung abgelöst werden.“6 Für die germanistische Literaturwissenschaft ist besonders die Studie von Simone Winko hervorzuheben, die Emotionen als einen „ eigenständigen Kode “ begreift, der „zugleich selbst kulturell kodiert ist“7. Winko unterscheidet in ihrer Analyse lyrischer und poetologischer Texte um 1900 zwischen der Thematisierung von Emotionen und der Präsentation von impliziten Emotionen: Mit dem Begriff der Thematisierung werden Propositionen in einem Text bezeichnet, „die sich auf Emotionen beziehen und die meist explizit formuliert, oftmals aber auch nur umschrieben werden“8. Unter Präsentation hingegen versteht Winko die „sprachliche Gestaltung von Emotionen“, also sprachliche Bezugnahmen auf Emotionen, die „keine Propositionen über Emotionen, sondern die Emotionen selbst“9 vermitteln. Mit ihrer Ausarbeitung eines systematischen Beschreibungs- und Analyseinstrumentariums hat Winko für die literaturwissenschaftliche Emotionsforschung Ähnliches geleistet wie RadaelliRadaelli, Giulia für die Mehrsprachigkeitsforschung.10
Wie diese kurzen Schlaglichter deutlich machen sollten, hat sich die germanistische und kulturwissenschaftliche Forschung im deutschsprachigen Raum mit dem Thema Emotionen in den letzten Jahren intensiv befasst. Diese Auseinandersetzung stand – zusätzlich motiviert durch die neurowissenschaftliche Konjunktur des Themas – in einem zeichentheoretischen Rahmen: Sie zielt vornehmlich auf die historische Genese sowie die Vermitteltheit von Emotionen und ihre Kontingenz.
Der Begriff der Affektivität, wie er im Titel des vorliegenden Bands auftaucht, ist gegenüber dieser Forschungslinie durchaus anders konturiert: Inspiriert von den englischsprachigen affect studies , die in der Germanistik bislang kaum rezipiert wurden, soll mit ihm eine spezifische Perspektive auf Gefühle, Emotionen und Affekte zum Ausdruck gebracht werden, die über den kultursemiotischen Zugang hinausweist. Für die Unterscheidung von Emotions- und Affektforschung heißt das: Nicht der Text- und Zeichencharakter von Emotionen steht im Vordergrund der Analysen, sondern die Affektivität der Zeichen und Texte selbst, die sich in sprachlichen Bildern, im Klang, in der Schrift oder im Satzbau zeigen. In Abgrenzung zum heute geläufigen Begriff von Affekt als „Bezeichnung für starke Regungen“, mit einer „klare[n] Bedeutungstendenz in Richtung des emotional Negativen“1, geht diese Perspektive auf ein grundlegend relationales Verständnis von Affekten und Emotionen zurück.
Eingeleitet wurde diese neuere Diskussion des Affektbegriffs durch zwei programmatische Aufsätze aus dem Jahr 1995: Zum einen „Shame in the Cybernetic Fold“2 von Eve Kosofsky SedgwickSedgwick, Eve Kosofsky und Adam FrankFrank, Adam sowie zum anderen „The Autonomy of Affect“3 von Brian MassumiMassumi, Brian. Während erstere das Anliegen verfolgen, die Affekttheorie des amerikanischen Psychologen Silvan TomkinsTomkins, Silvan in die humanities einzuführen und sich dabei dezidiert gegen deren habitualisierten Anti-Biologismus richten, greift letzterer auf eine durch SpinozaSpinoza, Baruch de und DeleuzeDeleuze, Gilles inspirierte Denktradition zurück, um ‚Affekt‘ von ‚Emotion‘ zu unterscheiden. In Massumis Vorstellung folgen Affekte und Emotionen „different logics and pertain to different orders“4. MassumiMassumi, Brian begreift den Affekt als präreflexive, vor- oder über-individuelle, nicht-sprachlich strukturierte („not semantically or semiotically ordered“5) Intensität, die eine gewisse Autonomie besitzt und nie restlos in kulturellen Codes und Bedeutungen aufgehen kann. Emotionen sind MassumiMassumi, Brian zufolge als „unvollständige[r] Ausdruck eines Affekts“6 zu verstehen. Das heißt, Emotionen sind Affekten stets nachgelagert. Die Emotion ist das Ergebnis einer Transformation: Sie ist gewissermaßen der Affekt im Aggregatzustand seiner Bändigung („capture“).
Читать дальше