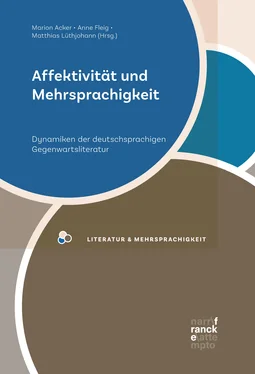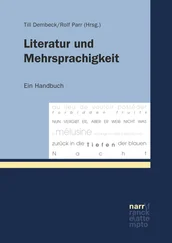Die affektive Qualität dieser Poetik ist im Durchbrechen der Routinen und Gewohnheiten von Einsprachigkeit zu erkennen, also in einer kämpferischen Sprachgeste, die durchaus gewaltsame Züge besitzt. Pastior stellt sich damit in eine Tradition, die etwa die Mehrsprachigkeit literarischer Übersetzungen als das Aufbrechen der Grenzen von Einsprachigkeit versteht. So heißt es in Walter BenjaminsBenjamin, Walter berühmter Abhandlung Die Aufgabe des Übersetzers von 1923, dass der Übersetzer die „morschen Schranken der eigenen Sprache bricht“11 und deren Grenzen dadurch erweitert.
Gemessen an der forcierten Experimentalästhetik eines PastiorPastior, Oskar, der im Gedichtband Mein Chlebnikov die russische und deutsche Sprache vereint, dessen Gedichte in den 1980er Jahren verborgene rumänische Sprachsplitter als Form der Ideologiekritik an der Ceaușescu-Diktatur einsetzen, und der in seinem Gesamtwerk ein Pluriversum schwirrender Mehrsprachigkeit evoziert und in Szene setzt, nehmen sich die Texte der Lyrikerin Rose AusländerAusländer, Rose vergleichsweise traditionell aus. Aber hier soll es auch nicht um die Suche nach möglichst avancierten Formen von Mehrsprachigkeit gehen, sondern um die Erkundung der Grundlagen von Mehrsprachigkeit in literarischen Texten einer bestimmten historisch-politischen und kulturellen Konstellation. Von hier aus lässt sich, bei allen sonstigen Unterschieden, eine Verbindung zwischen der Lyrik von AusländerAusländer, Rose und CelanCelan, Paul herstellen.
Die 1901 in Czernowitz, der Hauptstadt der Bukowina, als Rosalie Scherzer geborene Rose AusländerAusländer, Rose, ist eine wichtige Stimme der Literatur nach Auschwitz, der Literatur über die Shoah. Ihre Gedichte sind bereits einer ausführlichen poetologischen Lektüre unterzogen worden.1 In einem erstmals 1976 veröffentlichten Prosatext entwirft AusländerAusländer, Rose ein Erinnerungsbild von Czernowitz. In ihren Augen ist Czernowitz nach der Ermordung der jüdischen Bevölkerung eine „versunkene Stadt“, eine „versunkene Welt“.2 CelanCelan, Paul nennt in seiner Rede zur Entgegennahme des Bremer Literaturpreises von 1958 die Bukowina mit ihrer Hauptstadt Czernowitz eine „Gegend, in der Menschen und Bücher lebten“3. Das Präteritum macht deutlich, dass es sich um die unwiderrufliche Auslöschung einer ganzen Kultur handelt, die der „Geschichtslosigkeit anheimgefallen“4 sei.
In den einleitenden Passagen von AusländerAusländer, Roses Erinnerungsbild fallen besonders zwei Adjektive und eine Passage zur Sprachensituation in Czernowitz auf. Die Stadt wird gleich im ersten Satz „entlegen“5 genannt. Von wo aus wird diese Aussage getroffen? Offenbar von einem angenommenen Zentrum aus, dem Czernowitz als Rand erscheint. Und die Stadt wird „buntschichtig“6 genannt, was auf die wechselseitige Durchdringung der verschiedensprachigen Kulturen verweist. Daran schließt sich die folgende Passage an:
Die verschiedenen Spracheinflüsse färbten natürlich auf das Bukowiner Deutsch ab, zum Teil recht ungünstig. Aber es erfuhr auch eine Bereicherung durch neue Worte und Redewendungen. Es hatte seine besondere Physiognomie, sein eigenes Kolorit. Unter der Oberfläche des Sprechbaren lagen die tiefen, weitverzweigten Wurzeln der verschiedenartigen Kulturen, die vielfach ineinandergriffen und dem Wortlaub, dem Laut- und Bildgefühl Saft und Kraft zuführten.7
Bei aller positiven Konnotation, die die Intaktheit der vor dem Terror der Nationalsozialisten und der Shoah ineinandergreifenden Kulturen und deren bereichernden Einfluss auf die Worte betrifft, ist die Vorstellung einer „Oberfläche des Sprechbaren“ und des darunter liegenden Wurzelwerks, das nicht sprechbar ist, mithin sprachenlos, stumm bleibt, bemerkenswert. Ruht demnach die Mehrsprachigkeit, die, wenn der Begriff sinnvoll ist, irgendeine Form der ‚Sprachigkeit‘ impliziert,8 auf Verhältnissen, Relationen jenseits der Sprache und des Sprachlichen auf? Darauf wird im Verlauf der Überlegungen zurückzukommen sein. Es hat mit dem zu tun, was CelanCelan, Paul „das Geschehene“ und das „Geschehen“ nennt.9
Die Erinnerung an die ineinandergreifenden Kulturen und deren Einfluss auf das Sprechbare wird von AusländerAusländer, Rose auch lyrisch gestaltet. Im Gedicht mit dem Titel „Czernowitz vor dem Zweiten Weltkrieg“ findet sich die folgende Strophe:
Vier Sprachen
verständigen sich
verwöhnen die Luft10
Die Rede von den sich verständigenden Sprachen in Czernowitz erinnert an eine Zeit der Übereinkunft, die durch den Zusatz „vor dem Zweiten Weltkrieg“ klar markiert wird. Danach kann von solcher Verständigung nicht mehr die Rede sein. Im Gedicht „Czernowitz. ‚Geschichte in der Nußschale‘“ ist denn auch in der Gestalt eines Paradoxons vom Schweigen „in fünf Sprachen“11 die Rede.
Im bekannten Gedicht „Bukowina II“ taucht die Formulierung von den vier Sprachen, womit das Rumänische, Deutsche, Ukrainische und Jiddische gemeint sind, wieder auf:
Landschaft die mich
erfand
wasserarmig
waldhaarig
die Heidelbeerhügel
honigschwarz
Viersprachig verbrüderte
Lieder
in entzweiter Zeit
Aufgelöst
strömen die Jahre
ans verflossene Ufer.12
Auch hier kommt in der Aussage von der Verbrüderung der Lieder eine komplizierte Situation zum Ausdruck. Denn ungeachtet der in der letzten Strophe thematisierten Auflösung der Zeiteinheit der Jahre und dem im Partizip „verflossen“ angezeigten Konturverlust der einstmaligen Flusslandschaft, der mit der Vorstellung von Vergänglichkeit einhergeht, wird die vorangehende dritte Strophe von einer Koinzidenz des semantisch Entgegengesetzten bestimmt. Die von Liedern vollzogene Verbrüderung findet „in“ entzweiter Zeit statt, scheint also der gegenläufigen geschichtlichen Entwicklung zu trotzen. Diese Reflexion des Gegenläufigen setzt sich in der Überlegung fort, dass in vielen Gedichten AusländerAusländer, Roses Wort und Sprache als ein Bereich ausgewiesen werden, der der schreibenden Instanz – und nicht nur ihr – das Überleben sichert: „Schreiben war Leben. Überleben“13. Wort und Sprache sind ein Bereich, der die von der entzweiten Zeit ausgehende Verzweiflung überdauert, wenn auch nicht unversehrt. Im Altersgedicht „Hoffnung IV“ befördert das „aus der Verzweiflung / geborene[] Wort“ die zugestandenermaßen „verzweifelte[] Hoffnung, / daß Dichten / noch möglich sei“14. Und in einem der letzten Gedichte „Tröstung II“ heißt es: „Denk daran / wir haben / ein Königreich geerbt / aus Worten / das überlebt.“15 Es besteht kein Zweifel daran, dass dieses aus Worten bestehende Königreich dem mehrsprachigen Kosmos der „versunkenen Stadt“ Czernowitz entstammt und aufgrund der Erinnerung an die dort stattgefundene Vereinigung der Sprachen und Verbrüderung der Lieder in sich mehrsprachig ist. Der Aspekt des Gemeinschaftsbildenden, der die Vorgänge der Vereinigung und Verbrüderung verbindet, weist dabei auf die soziale Dimension des von AusländerAusländer, Rose ins Auge gefassten Sprachgeschehens hin. Dieses besitzt in der „Verbrüderung“ unverkennbar eine affektive Qualität.
Der Weg Paul CelanCelan, Pauls von Czernowitz nach Paris verläuft nicht geradlinig, sondern auf „Umwegen“.1 Die vom Terror der Nationalsozialisten und den Umbrüchen nach dem Zweiten Weltkrieg erzwungene Migration führt ihn, der überlebt hat, nach der Ermordung seiner Eltern in den Lagern der Nazis zunächst nach Bukarest, wo er Gedichte in rumänischer Sprache schreibt, und dann nach Wien, wo er seine ersten beiden Bücher veröffentlicht. Im Sommer 1948 kommt er in Paris an, wo er bis zu seinem Freitod im Jahr 1970 wohnt. CelanCelan, Paul und AusländerAusländer, Rose sind sich erstmals in den 1940er Jahren in dem von SS-Truppen besetzten Czernowitz begegnet. Nach dem Krieg besucht AusländerAusländer, Rose, die von 1950 bis 1961 in New York lebt und englischsprachige Gedichte schreibt, CelanCelan, Paul 1957 in Paris. Danach schreibt AusländerAusländer, Rose Gedichte wieder in deutscher Sprache und verzichtet fortan auf den Reim.
Читать дальше