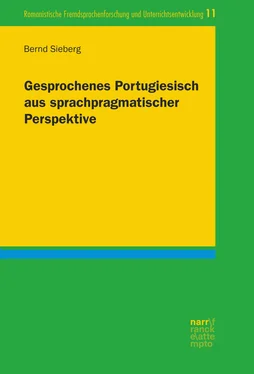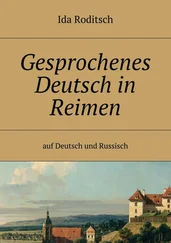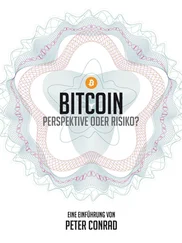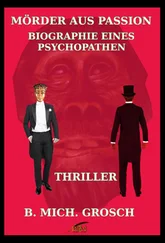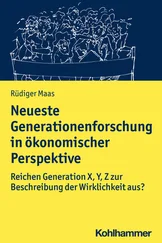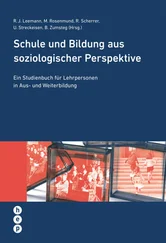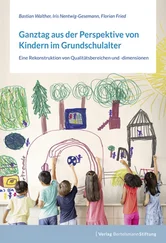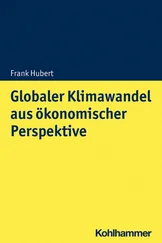Die Aufgabe in den nächsten Kapiteln wird nun darin bestehen, die oben nur kurz und vorläufig angedeuteten Charakteristika des prototypischen Nähesprechens, zu denen sowohl sprachliche Ausdrücke, aber auch spezifische Gestaltungen der Sprechsequenz gehören, in ihren formalen und funktionalen Details ausführlich zu beschreiben. Dazu bleibt festzuhalten, dass diese Merkmale, die Textexemplare aus dem Bereich der ‚kommunikativen Praktiken‘ des Nähesprechens prägen, keine Aufgaben für die eigentliche Informationsübermittlung (den propositionalen Anteil des Sprechaktes) übernehmen. Auch lassen sie sich nicht als Elemente der langue im Sinne einer formal-strukturalistischen Sprachbeschreibung bestimmen. Entsprechend entziehen sie sich Bestimmungen, die sich z.B. die Generative Transformationsgrammatik in der Nachfolge Chomskys oder die Varianten der Verbvalenzgrammatik für die Bestimmung sprachlicher Elemente zum Ziel setzen. Wenn man diese Perspektiven einnimmt, könnte man sogar provokativ anmerken, dass die vorliegende Studie ausschließlich die ‚Reste‘ thematisiert, die für formal-strukturalistische Sprachbeschreibungen keine Rolle spielen. Letztere lassen sie ausdrücklich unberücksichtigt, weil sie aus der Perspektive ihrer Zielsetzung keine Rolle spielen, wie aus dem folgenden Zitat Chomskys (Chomsky 1965, 3) deutlich wird:
Linguistic theory is concerned primarily with an ideal speaker-listener, in a complete homogeneous speech-community, who knows its language perfectly and is unaffected by such grammatically irrelevant conditions as memory limitations, distractions, shifts of attention and interest, and errors (random or characteristic) in applying his knowledge of the language in actual performance.
Eine angemessene und ihrer Bedeutung entsprechende Beschreibung der Ausdrücke und Strukturen, die oben in ‚Text 2‘ skizzenhaft vorgestellt wurden, wird aber unter der Perspektive der Sprachpragmatik14 zwingend notwendig. In ihrer umfassenden Bedeutung schließt diese pragmatische Sichtweise Funktionen mit ein, die Aspekte der situativen (räumlich/zeitlichen) Einbindung, des diskursiven Verlaufs, der inner- und außersprachlichen Kontexte – einschließlich der sich aus ihnen ableitbaren Präsuppositionen – sowie der sozialen Interaktion des sprechsprachlichen Handelns betreffen.15 Sprachliche Kommunikation findet aus dieser Sicht nicht zwischen idealen Sprechern im Vakuum eines abstrakten Raums und zeitlicher Ungebundenheit statt. Stattdessen spielt sie sich zwischen real existierenden Gesprächspartnern mit ihren aufeinander stoßenden und möglicherweise auch unterschiedlichen Interessen, Gefühlslagen, allgemeinem Welt- und spezifischem Vorwissen, Sympathien etc. ab. Zudem ist sie in konkrete Situationen eingebunden und raumzeitlichen Bedingungen ausgeliefert, die Auswirkung auf die sprachlichen Ausdrücke und Strukturen nehmen, die Sprecher unter diesen Bedingungen benutzen, bzw. deren Gebrauch Sprecher diesen Bedingungen anpassen. Um ein Beispiel zu geben: Wer in Portugal einen Kaffee mit einigen Tropfen kalter Milch möchte, wird in der entsprechenden Situation, vielleicht an der Theke einer pastelaria gelehnt, einen café, pingado se faz favor! 16 bestellen. Die Möglichkeit, seinen Wunsch in dieser elliptischen Form vorzutragen und die spezifische Bedeutung von ‚mit einigen Tropfen kalter Milch‘ des Zusatzes pingada ergibt sich als Folge einer zur Konvention gewordenen Formulierung, die sich genau für diesen Bezeichnungszweck und diese Situation bei kompetenten portugiesischen Sprechern in (vielleicht) Jahrzehnten herausgebildet hat. Diese Form einer „Handlungsellipse“, d.h. von „Aufforderungen zu Handlungen in stark vorstrukturierten Situationen“ (Ágel / Hennig 2007, 201) entspricht in der Sprachwissenschaft Bühlers „empraktischen Nennungen“ ([1934]1982, 155sqq.). Im Rahmen des Modells des Nähe- und Distanzsprechens werden entsprechende Ausdrücke als ‚Handlungsellipsen‘ unter dem Beschreibungsparameter ‚Situation‘ erläutert. Das bedeutet, es sind sprachliche Mittel, in denen sich das universale Diskursverfahren ‚Verflechtung von Sprechen und non-verbalem Handeln‘ manifestiert (cf. ‚Kapitel 4‘).
Für das Ziel dieser Arbeit, aus sprachpragmatischem Blickwinkel die oben erwähnten sprachlichen Mittel und Strukturen in ihrer formalen und funktionalen Vielfalt in einer systematischen, nachvollziehbaren und verständlichen Art und Weise zu Gruppen zusammenzufassen (Stichwort Operationalisierbarkeit), erweist sich das Modell des „Nähe- und Distanzsprechens“ in seiner von Ágel / Hennig optimierten Variante, die seine konzeptionellen Voraussetzungen, Begriffe, Definitionen und seine Terminologie mit einschließt, als geeigneter Rahmen. Die Gliederung dieses Buches in Kapitel und Unterkapitel orientiert sich infolgedessen an den im Modell des Distanz- und Nähesprechens postulierten Beschreibungsparametern ‚Rolle‘, ‚Zeit‘, ‚Situation‘, ‚Code‘ und ‚Medium‘, den ‚Universalen Diskursverfahren‘, die sich diesen Parametern zuordnen lassen sowie den sprachlichen Mitteln, in denen sich diese Verfahren in einer Sprache manifestieren.
Alle im Buch vorgenommenen Analysen und kategorialen Bestimmungen von Nähemerkmalen folgen hierbei genau vorgeschriebenen Schritten, die ich am Beispiel der „Reaktive“ (Sieberg 2016, 101sqq.) folgendermaßen verdeutliche: Erster Schritt: Ausgehend vom Studium und der vorläufigen Analyse einiger Transkriptionen aus dem ‚CLUL-Korpus‘ sowie ersten Hinweisen aus der Sekundärliteratur fallen sprachliche Ausdrücke auf, die direkt nach dem Sprecherwechsel gebraucht werden, und deren Funktion darin zu bestehen scheint, spontan und effizient auf die vorhergehende Äußerung des Gesprächspartners zu reagieren. Zweiter Schritt: Im Modell – siehe seine vereinfachte und schematische Darstellung in ‚Kapitel 4‘ – findet man unter dem Beschreibungsparameter ‚Zeit‘ das universale Diskursverfahren ‚Einfache Verfahren der Einheitenbildung‘, dem sich diese Gruppe von ‚Reaktiven‘ zuordnen lässt, weil der Gebrauch von Ausdrücken wie claro, certo, exatamente, ai é, nem pensar, acho que sim, etc. auf den Einfluss dieses Verfahrens zurückgeführt werden kann, bzw. weil sich dieses Diskursverfahren in diesen sprachlichen Mitteln manifestiert. Dritter Schritt: Durch eine vertiefende Lektüre entsprechender Sekundärliteratur sowie eine weitere Suche im empirischen Material, die zu einer Vergrößerung des Repertoires von passenden tonalen Zeichen, Wörtern und Wortverbindungen führt, gelangt man schließlich zu einer Definition dieser Gruppe von Nähemerkmalen, die formale und funktionale Charakteristika der ‚Reaktive‘ so treffend und umfassend wie möglich bestimmt: „Sprecher gebrauchen Reaktive direkt nach dem Sprecherwechsel und verfügen mit ihnen über ein sprachliches Mittel, das es ihnen erlaubt, spontan Stellung zu den vorangehenden Äußerungen der Gesprächspartner und den mit ihnen verbundenen Geltungsansprüchen (illokutive Bestandteile der Sprechakte) zu nehmen“ (cf. Kapitel 6.2.1).
Angesichts des von mir gesteckten Ziels – man beachte nur die Vielzahl und Heterogenität der zu beschreibenden sprachlichen Erscheinungen – sollte es den Leser nicht verwundern, dass meine Recherchen keinen umfassenden Überblick über die entsprechende Sekundärliteratur liefern, die es zu den jeweiligen Phänomenen im Bereich der germanistischen und luso-brasilianischen Sekundärliteratur gibt. In Orientierung an dem Ziel, das bereits im Vorwort formuliert wurde, geht es in dieser Arbeit vielmehr darum, durch die Übernahme eines Konzepts der germanistischen GSF portugiesisches Nähesprechen angemessen und durch nachvollziehbare Operationen beschreiben zu können. Folglich liegt auch der Schwerpunkt und der Ausgangspunkt dieser Recherche vornehmlich im Bereich der germanistischen Sekundärliteratur zur GSF.
Читать дальше