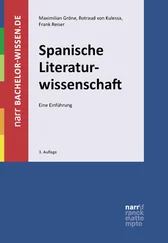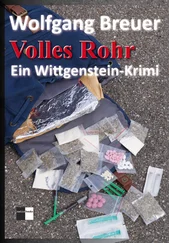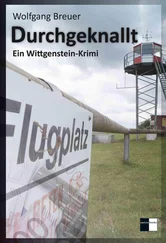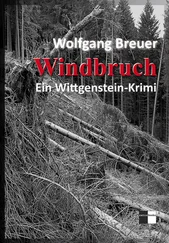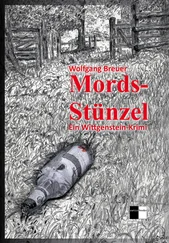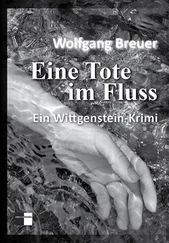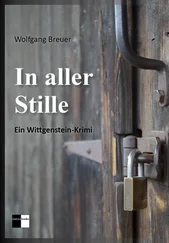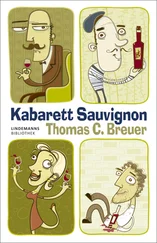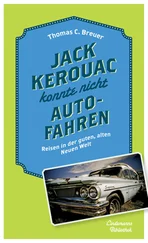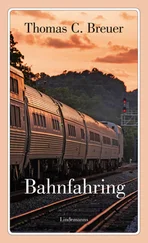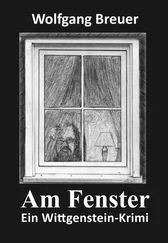Ein weiteres Beispiel für die in bestimmten Kreisen so beliebte Einebnung der Distanz zwischen Subjekt und Objekt in der Literaturwissenschaft ist die Theorie, Literatur und Literaturtheorie beziehungsweise Literaturkritik hätten denselben ontologischen Status und seien ununterscheidbar. Auch diese These ist nicht ganz falsch. Angesichts einer humorlosen Abhandlung über den Witz oder einer trockenen Statistik über die Liebe unter Jugendlichen heute hat sicher schon mancher die Grenzen einer naturwissenschaftlich distanzierenden Geisteswissenschaft gespürt. In diesem Sinne sagte Friedrich Schlegel, Poesie könne nur durch Poesie kritisiert werden. Für das Verhältnis zwischen Beobachter und Welt ist die These (aus dem Neuplatonismus stammend) vielleicht am schönsten in Goethes Xenie ausgedrückt: „Wär’ nicht das Auge sonnenhaft, / Die Sonne könnt’ es nie erblicken“. Aber selbst ein philosophischer Laie erkennt schnell, dass das nur ziemlich vage stimmen kann. Augenhaft muss Goethes Auge auch gewesen sein, denn um die Aussage machen zu können, dass Augen sonnenhaft sind, um die Sonne erblicken zu können, musste er vorher Augen erblickt haben, was nach seiner Aussage nur gelingt, wenn sie – auch – augenhaft sind. Wie alles andere, was Augen sonst noch sehen können, müssten Augen aber auch sein. Man erkennt, dass die Aussage letztlich ziemlich nichtssagend ist. Tatsächlich ist es mit unseren Augen so, dass sie besonders gut in dem Bereich der elektromagnetischen Wellen sehen können, in dem die Sonne besonders intensiv abstrahlt. Unsere Augen sind entstanden unter dem jahrmillionenlangen Einfluss des Lichts der Sonne. Wenn man das auf das Verhältnis zwischen Sprache und besprochener Welt übertragen darf, so heißt es: Von der Objektsprache (Dichtung) muss ein Einfluss ausgehen auf die Beschreibungssprache (Literaturwissenschaft), sonst kann diese jener nicht gerecht werden. Aber die Beschreibungssprache braucht nicht zu werden wie die Objektsprache – sie darf es sogar nicht, denn die Sonne kann sich ja gerade nicht sehen (und sogar das Auge kann sich selbst nicht sehen). Und: Die Sonne ist das Primäre, das Auge das Sekundäre.
Nun wird in der Praxis meistens nicht so heiß gegessen wie in der Theorie gekocht. Noch habe ich keine Dissertation gesehen, die ich für einen Roman hätte halten können, auch wenn die Wissenschaftsprosa mancher neuerer Autoren nicht dem Ideal durchsichtiger Klärung von Sachverhalten folgt, sondern Eigenwert zu beanspruchen scheint. Aber ich habe immerhin schon eine Habilitationsschrift in der Hand gehabt, deren Verfasserin sich weigerte, in der Bibliographie zwischen Primär- und Sekundärliteratur zu unterscheiden, weil das nicht auf der Höhe der Theorie gewesen wäre, und das in einer Arbeit, die bisher vernachlässigte und in Vergessenheit geratene Romane erschließen will, wo also jeder Leser gerne auf einen Blick sehen würde, welche Romane denn da wiederentdeckt werden. Da die Theorie aber besagt, dass es keine Wahrheit gibt, Tarskis Differenzierung zwischen Objektsprache und Metasprache aber getroffen wurde, um Aussagen Wahrheit zusprechen zu können, ist es tatsächlich widerspruchsfrei, nicht zwischen logischen Ebenen zu unterscheiden. Da kann man dann nur sagen: Hat es auch Methode, so ist es doch Wahnsinn. Und man sieht, wie wichtig der Grundsatz der Fremdkontrolle ist, denn Auswüchse wie diese sind nur in einer Situation des Ingroup-Provinzialismus verstehbar.
Und wieder zeigt sich das Autoritäre der Theorie, Literatur und Literaturwissenschaft seien ununterscheidbar. Eine Studie, die durch ihren Stil verlangt, dass sich der Leser ganz auf sie einlassen muss, um sie nachvollziehen zu können – etwas, das das Kunstwerk verlangen darf –, will nicht durch Argumente einen freien Leser überzeugen, sondern durch imperiale Gesten beeindrucken. Der Ornithologe will fliegen.
Im Zusammenhang der Theorie, Literatur und Literaturwissenschaft seien untrennbar, wird auf Einwände hin gelegentlich geantwortet, die traditionelle Differenzierung zwischen den logischen Ebenen des Kommentierten und des Kommentars sei vielleicht bei traditioneller Literatur angebracht gewesen, etwa bei realistischen Romanen des vorigen Jahrhunderts, die ihrerseits von einer objektivistischen Konzeption der Wirklichkeit, vom Glauben an Wahrheit, vom Gedanken an die Trennung von Subjekt und Objekt usw. durchdrungen seien; sie sei aber auf jeden Fall unangebracht bei literarischen Werken, die selbst die Trennung von Subjekt und Objekt der Beschreibung in Frage stellen. Tatsächlich gibt es ja seit einigen Jahrzehnten, vor allem im angelsächsischen Sprachraum, eine umfangreiche Tradition von Erzählliteratur dieser Art. Meta-Literatur ist ein Beispiel, also Literatur, deren Gegenstand die Niederschrift des Werks selbst ist, etwa Becketts Malone stirbt . Sodann gibt es Romane, die wie Literaturkritik aussehen, etwa Julian Barnes’ Flauberts Papagei . Und schließlich gibt es eine Vielzahl fiktiver Autobiographien und Biographien, bei denen die Darstellung objektiv gegebener Realität und fiktionale Dichtung ineinander übergehen, früh schon Virginia Woolfs Orlando und kürzlich Robert Nyes Memoirs of Lord Byron oder Peter Ackroyds Chatterton . Solche Literatur kann in Beziehung gesetzt werden zu der zunehmenden Tendenz des allgegenwärtigen Mediums Fernsehen, die Trennung zwischen Realität und Fiktion verschwimmen zu lassen. Man denke nur an die stufenlose Linie vom traditionellen Spielfilm über den nachgestellten Kriminalfall bis hin zu Reality-TV und Kriegsberichterstattung aus dem Hotelfenster heraus, und das Ganze vielleicht noch dauernd von Werbespots und Videoclips unterbrochen, und man wird einsehen, dass die alte Differenzierung mit bloß zwei Kategorien (real oder fiktiv) zu grobschlächtig ist. Aber gerade wenn es für die Menschen de facto immer schwieriger wird zu unterscheiden, muss die begriffliche Differenzierung umso sorgfältiger sein. Bei zunehmender Brutalität an den Schulen sagt der Pädagoge ja auch nicht: Dann geben wir eben die Unterscheidung von Gewalt und Friedfertigkeit auf!
Natürlich muss das Handwerkszeug der Literaturwissenschaft, die Begrifflichkeit usw. angesichts neuer Gattungen und Gattungsmischungen geschärft und erweitert werden, aber deswegen müssen nicht etwa die Kategorien aufgeweicht werden. Einen Prozess der Aufweichung von Objekten kann ich gerade nur mit einer harten Sprache feststellen, einen geschichtlichen Entwicklungsprozess nur mit statischen Begriffen. Außerdem scheint die Theorie auch hier weiter zu sein als die Praxis. Die fernseherfahrenen Kinder der Gegenwart jedenfalls unterscheiden in ihren Reaktionen (zum Beispiel im Grad ihrer Angst) deutlich zwischen Realität und Fiktion auf dem Bildschirm. Schon Aristoteles baute seine Funktionsbestimmung der Tragödie darauf auf, dass der Zuschauer auf eine auf der Bühne gespielte Gewalttat anders reagiert als auf eine vor unseren Augen auf der Straße.
Es braucht den Theoretiker oder Interpreten auch nicht zu beirren, dass ein Autor wie beispielsweise Ackroyd offenbar selbst an die neuen Theorien glaubt, die er seinen Romanen zugrunde legt, und sie nicht etwa nur als Spielvorlage betrachtet. Wie man im Sommer 1993 in der Times lesen konnte, hält Ackroyd Einsteins Relativitätstheorie – ganz im Sinn poststrukturalistischer Wissenschaftssoziologie – für einen Mythos. Naturwissenschaftliche Theorien sind gewiss Modelle, aber deswegen noch keine Fiktionen im Sinne von Dichtungen. Und so hat auch trotz manch kühner allgemeiner Meta-Theorie noch kein Wissenschaftssoziologe ernstlich konkret gesagt, wieso das heliozentrische Weltbild oder die Theorie Harveys vom Blutkreislauf nur fiktionale Erzählungen sein sollen. Als Dichter darf Ackroyd das natürlich denken, und man kann ihn trotzdem schätzen, so wie man ja auch kein mittelalterlicher Katholik sein muss, um Dantes Göttliche Komödie zu bewundern, kein Anhänger der höfischen Liebe, um Chaucers Troilus und Criseyde zu lieben. (Allerdings darf man Dantes oder Chaucers Weltbild auch nicht absurd oder verächtlich finden, sonst wird einem die nötige Empathie fehlen.) Man könnte sogar argumentieren, dass Literatur gerade da ihre ureigenste Provinz hat, wo sie interessante Gedankenspiele vorführt, die in der Wirklichkeit unmöglich sind, sei es praktisch wie oben bei Borges, sei es logisch wie in Wells’ Zeitmaschine .
Читать дальше