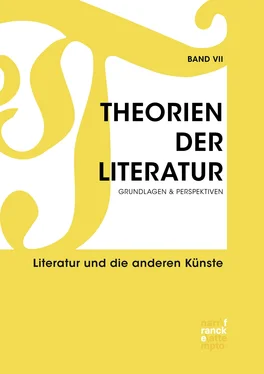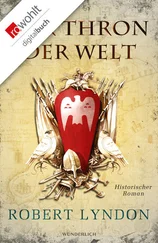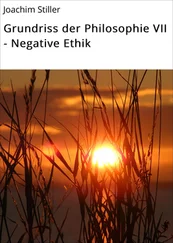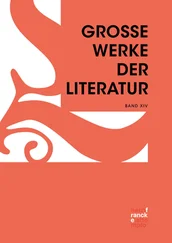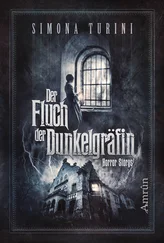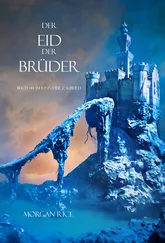Niefanger, Dirk:„‚Keine Natur mehr, sondern nur Bilder‘. Goethes Abschied vom Vesuv“. ‚Von der Natur zur Kunst zurück‘. Neue Beiträge zur Goethe-Forschung. Hgg. Moritz Baßler und Christoph Brecht u.a. Gotthart Wunberg zum 65. Geburtstag. Tübingen 1997. 109–126.
Ortel, Phillippe: La littérature ou l’ère de la photographie. Enquête sur la révolution invisible. Nîmes 2002.
O.V.:„Grand Tour”. The Oxford English Dictionary. Hg. John Simpson und Edmund Weiner. Oxford 1989.
Pfisterer, Manfred:„Paragone“. Rhetorisches Wörterbuch der Rhetorik . Bd. 6. Hg. Gert Ueding. Tübingen 2003.
Savy, Nicole:„Arrêt sur image: le Portrait d’ Émile Zola par Édouard Manet“. Impressionnisme et littérature . Hgg. Gérard Gengembre und Yvan Leclerc u.a. Mont-Saint-Aignan 2012. 51–61.
Simonis, Annette und Linda Simonis:„Der Vergleich und Wettstreit der Künste. Der ‚Paragone‘ als Ort einer komparativen Ästhetik“. Comparative Arts. Universelle Ästhetik im Fokus der vergleichenden Literaturwissenschaft. Hg. Achim Hölter. Heidelberg 2011. 73–86.
Tauber, Christine:„Paragone“ . Lexikon der Kunstwissenschaft. Hundert Grundbegriffe. Hg. Stefan Jordan und Jürgen Müller. Stuttgart 2012. 259–261.
Westerwelle, Karin:„Einleitung“. In: Charles Baudelaire. Dichter und Kunstkritiker. Hg. Karin Westerwelle. Würzburg 2007. 9–26.
Wilm, Marie-Christin:„Laokoons Leiden. Oder über eine Grenze ästhetischer Erfahrung bei Winckelmann, Lessing und Lenz“. Ästhetische Erfahrung: Gegenstände, Konzepte, Geschichtlichkeit. Hg. Sonderforschungsbereich 626. Berlin 2006. ( http://www.sfb626.de/veröffentlichungen/online/aesth_erfahrung/aufsaetze/wilm.pdf)
Wodianka, Stephanie:„Das bereiste Andere: Der ‚italienische Blick’ am Fuße des Vesuv auf den Grand Tour und die europäische Reiseliteratur“. Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte/Cahiers d’Histoire des Littératures Romanes 32 (2011), 3/4: 467–486.
–:„Spiegelbilder. Der Dritte Ort des Todes bei Baudelaire“. Bild und Tod . Hgg. Philipp Stoellgner und Jens Wolff. Tübingen 2016. 281–298.
–:„Welches Sizilien? Vittorini, Pirandello und Rossellini am Fuße des Stromboli”. Reiseziel Italien. Moderne Konstruktionen kulturellen Wissens in Literatur – Sprache – Film. Hgg. Alessandra Lombardi und Lucia Mor u.a. Frankfurt a.M. 2014. 191–212.
Instrumentalwerke als poetologische Modelle in Empfindsamkeit, Romantik und Moderne
Christine Lubkoll
In seinem Aufsatz über Symphonien , den Ludwig Tieck 1799 in den zusammen mit Wilhelm Heinrich Wackenroder verfassten Phantasien über die Kunst herausbrachte, findet sich folgende Charakteristik der musikalischen Gattung:
Diese Symphonien können ein so buntes, mannigfaltiges, verworrenes und schön entwickeltes Drama darstellen wie es uns der Dichter nimmermehr geben kann; denn sie enthüllen in rätselhafter Sprache das Rätselhafteste, sie hängen von keinen Gesetzen der Wahrscheinlichkeit ab, sie brauchen sich an keine Geschichte und an keine Charakter [sic] zu schließen, sie bleiben in ihrer rein–poetischen Welt.1
Diese Überlegungen sind aus mehreren Gründen bemerkenswert. Erstens ist es zunächst nicht selbstverständlich, dass hier ein Dichter sich über die Symphonie äußert, dass er die musikalische Kompositionskunst überhaupt für diskussionswürdig erachtet. Verständlich wird dies erst, wenn man bedenkt, dass die Symphonie im 18. Jahrhundert eine relativ junge Gattung war und dann aber enorm schnell zu einer Hochblüte gelangte; außerdem beginnt um 1800 (im Spannungsfeld von Empfindsamkeit, Klassizismus und Romantik) eine intensive poetologische Reflexion, die den Stellenwert und das Ausdruckspotential der Literatur im Vergleich mit anderen Künsten zu bestimmen versucht.
Das führt zum zweiten Punkt: Auffällig an den Ausführungen Tiecks ist zudem, dass er die Symphonie mit einem literarischen Text vergleicht (dem Drama), dass er aber die Musik klar als eine überlegene Darstellungsform betrachtet. Dies ist durchaus erstaunlich, wenn man den Umstand berücksichtigt, dass die Musik im ästhetischen Diskurs überhaupt erst seit dem späten 17. Jahrhundert als eigenständige Kunst bewertet (und behandelt) wurde2; in den septem artes liberales wurde sie noch – im Quadrivium – in eine Reihe mit der Arithmetik, der Geometrie und der Astronomie gestellt. Allerdings ist die Formulierungsweise Tiecks durchaus ambivalent: Denn die Favorisierung der Symphonie (als musikalisches Kunstwerk) geschieht ja wiederum unter Rückgriff auf Begriffe aus der Dichtung: Zum einen wird die Musik als eine Sprache (und nicht etwa: eine Tonkunst) bezeichnet; zum anderen wird sie als eine quasi gehobene Form der Dichtung gefeiert: „in ihrer rein–poetischen Welt“.3
In diesem Sinne wird die Musik – und hier besonders die Symphonie – im poetologischen Diskurs um 1800 oftmals als Vorbild für die Literatur ‚instrumentalisiert‘. Die ‚rein poetische Welt‘, die sich nicht an die „Gesetze der Wahrscheinlichkeit“, an „keine Geschichte“ und an „keine Charakter[e]“ halten muss, wird zum Ideal schlechthin erhoben.4
Damit aber nicht genug: Die Nobilitierung der Symphonie zum poetologischen Modell ist nicht nur eine vorübergehende ‚Mode‘ um 1800, sondern sie prägt sich dem literarischen und kulturellen Diskurs derart ein, dass sich die Künste bis in die Moderne und Gegenwart daran abarbeiten.
Die Rezeptionsgeschichte des literarischen Symphonie-Diskurses soll im Folgenden nachgezeichnet werden. Am Anfang stehen einige Überlegungen zur Verortung des Themas im komparatistischen Grenzgebiet ‚Musik und Literatur‘ .Auch wenn hier der Bereich der musikliterarischen Forschung nicht allgemein, sondern exemplarisch vorgestellt werden soll, erscheinen doch einige theoretisch-methodische Grundlagen hilfreich. Zweitens werden im Vorfeld der musikwissenschaftliche Begriff der Symphonie und die musikhistorische Entwicklung der Gattung skizziert, bevor im Hauptteil dann die ‚Karriere‘ des Symphonie-Diskurses in der Literaturgeschichte in einem Dreischritt erläutert wird: Zunächst geht es hier um empfindsame Anverwandlungen im Rahmen der im späteren 18. Jahrhundert aufkommenden Ausdrucks- und Gefühlsästhetik (Wilhelm Heinse, Wilhelm Heinrich Wackenroder); sodann nehme ich romantische Perspektivierungen in den Blick: zum einen die wirkungsästhetischen Reflexionen, die die „verworrene“ Komplexität der Symphonie als Gefährdung des Subjekts beschreiben (Brentano/Görres), zum anderen deren Idealisierung als polyphones Strukturideal im Sinne der progressiven Universalpoesie der Romantik (E.T.A. Hoffmann). Drittens gehe ich dann auf die Frage ein, wie das kulturgeschichtlich wirksame Paradigma der ‚Symphonie‘ in der Moderne rezipiert wird: Dabei rückt einerseits ein literarischer Text in den Fokus: Thomas Manns Roman Doktor Faustus und das vom Protagonisten verfolgte Postulat der ‚Zurücknahme‘ von Beethovens 9. Symphonie. Andererseits gewinnen auch Transformationen des Strukturideals im Medium des Films an Bedeutung – dies wird am Beispiel von Walter Ruttmanns Film Berlin – Die Sinfonie der Großstadt kurz angedeutet.
Zunächst zu einer kurzen Verortung des Themas im Forschungsgebiet ‚Musik und Literatur‘: Stephen Paul Scher hat in seinem einschlägigen Handbuch Literatur und Musik folgendes Schema entwickelt:1
Читать дальше