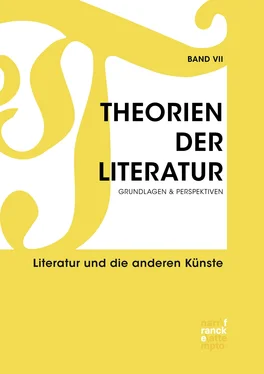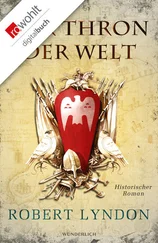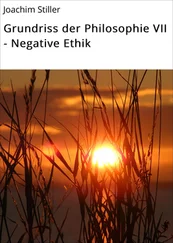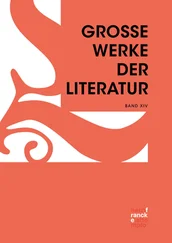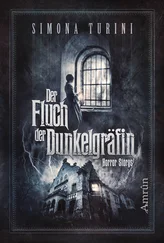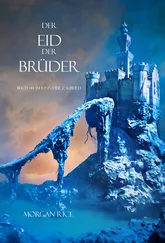[…] c’est l’investigation scientifique, c’est le raisonnement expérimental qui combat une à une les hypothèses des idéalistes, et qui remplace les romans de pure imagination par les romans d’observation et d’expérimentation.10
Jedoch ‘dirigiert’ der naturalistische Dichter nach der Poetik Zolas die positivistisch beobachteten Tatsachen in seinem Werk so, dass es die Mechanismen der Wirklichkeit ersten Grades zur Darstellung zu bringen vermag. Hier entsteht der für die Literatur notwendige Freiraum, der sich von ‚reiner Beobachtung‘ genauso emanzipiert weiß wie von reiner Imagination:
Nous partons bien des faits vrais, qui sont notre base indestructible; mais, pour montrer le mécanisme des faits, il faut que nous produisons et que nous dirigions les phénomènes; c’est là notre part d’invention, de génie dans l’œuvre […] Ainsi donc, au lieu d’enfermer le romancier dans des liens étroits, la méthode expérimentale le laisse à toute son intelligence de penseur et à tout son génie de créateur.11
Und auch die folgende Passage ist nur bei naiver Lektüre als Ausdruck ungebrochener tiefster Bewunderung zu sehen:
Ce portrait est un ensemble de difficultés vaincues ; depuis les cadres jusqu’au fond, depuis le charmant paravent japonais qui se trouve à gauche, jusqu’aux moindres détails de la figure, tout se tient dans une gamme savante, claire et éclatante, si réelle que l’oeil oublie l’entassement des objets pour voir simplement un tout harmonieux.12
Die Malerei tut sich schwer, sie ist bei der von Zola als Ideal gesetzten naturalistischen Darstellung mit Hindernissen konfrontiert, die Manet als Ausnahmeerscheinung überwunden hat, sein Werk aber trotzdem noch als ein Ensemble dieser genommenen Hürden erscheinen lässt – wenngleich eine Hürden-Komposition, die einen harmonischen Gesamteindruck erzielt, weil das Auge die Disparatheit ‚vergisst‘ – ein kleiner Seitenhieb auf die Malerei, die von der Schwäche des leicht täuschbaren menschlichen Gesichtssinnes profitiert. Zola fährt fort und bedient sich der rhetorischen Figur der Paralipse, um auf die Detailhaftigkeit aufmerksam zu machen, für die er Manet schätzt – auch wenn die naturalistische Malerei grundsätzlich nicht an die Literatur heranzureichen vermag:
Ich spreche erst gar nicht von den Objekten, von den Accessoires und Büchern, die auf dem Tisch herumliegen: Edouard Manet hat sich hier als Meister bewährt. Sondern ich empfehle ganz besonders die auf dem Knie der Figur ruhende Hand; das ist ein Wunderwerk. Hier endlich einmal Haut, echte Haut, ohne lächerliche Augentäuschung.13
Das ‚Wunderwerk‘ besticht nach Zola gerade dadurch, dass es seine ‚Echtheit‘ nicht aus dem Versuch gewinnt, das Auge zu täuschen und die Grenzen zwischen Realität und Kunst zu vermischen. Mimesis bedeutet immer Wirklichkeit zweiten Grades, und Literatur und Malerei werden gleichermaßen lächerlich, wenn sie das zu vertuschen suchen.
In einer noch grundsätzlicheren Hinsicht und durch eine grundlegende Strategie ist die Bildbeschreibung Zolas Auszug aus dem Salon de 1868 nicht nur Lob des naturalistischen Malers, sondern ein Plädoyer im Kontext der Paragone -Debatte: Zola entscheidet sich für ein ekphrastisches Künstlerlob, das zugleich auf jene blinde Flecken des bzw. eines jeden Gemäldes verweist, die in den Bereich spezifisch literarischer Kompetenzen fallen. Zolas ‚Bildbeschreibung‘ ist keine Beschreibung des Porträts, sondern eine Beschreibung seines Herstellungsprozesses. Er beschreibt, wie der Künstler Manet ihn malte und vor allem, welche Perspektiven der Rückblick des Porträtierten eröffnete und welche Bereiche des (geräuschvollen) Fühlens und Denkens für den Maler unerreichbar bleiben mussten – trotz aller ‚naturalistischer‘ Professionalität. Die Umkehrung des Blicks und die Flexibilität der Fokalisierung sind es, die die Literatur in die Waagschale der Künste wirft. Der Paragone zwischen Photographie einerseits und Malerei und Literatur andererseits wäre für Zola leicht entschieden.14 Im Paragone zwischen naturalistischer Malerei und naturalistischer Literatur sieht sich Zola gezwungen, subtiler zu argumentieren. Dass er sich dabei in die Argumentationstradition von Lessings Laokoon stellt, ist offensichtlich.
5. Charles Baudelaire: Literatur als Gegenteil von Photographie
Baudelaire wird im Jahr 1859 vom Herausgeber der Revue française aufgefordert, die gerade in Paris laufende Ausstellung zeitgenössischer Künstler zu kommentieren. „Soyez bref“, soll er zu Baudelaire gesagt haben, „ne faites pas un catalogue, mais un aperçu général, quelque chose comme le récit d’une rapide promenade philosophique à travers les peintures.“1 Baudelaire entspricht diesem Wunsch, und im Folgenden und letzten Abschnitt wird diesem mit Le Portrait betitelten Essai zum Salon de 1859 , wie er in der Revue française des gleichen Jahres publiziert wurde, eine zentrale Rolle zukommen – als Referenzpunkt für meine Interpretation des ebenfalls mit Un portrait betitelten Sonetts der Fleurs du Mal 2 und für eine Analyse zur Bestimmung des Literarischen im Paragone mit der Photographie, in Koalition mit Malerei und Zeichnung.
Baudelaire führt in jener kunstkritischen Abhandlung Salon de 1854 unter der Kapitelüberschrift Le portrait eine imaginierte Diskussion mit einem fiktiven Gegenüber. Diese Szene ist unübertrefflich – an Bissigkeit und Bourgeoisie-Verachtung, aber auch an programmatischer Schärfe in Bezug auf den Paragone . Literatur und Malerei sind hier vereint im Wettstreit gegen die Photographie, die die Bedürfnisse der von Baudelaire verhassten bürgerlichen Seelen bedient und bestätigt:
En face de moi, je vois l’Ame de la Bourgeoisie, et croyez bien que si je ne craignais pas de maculer à jamais la tenture de ma cellule, je lui jetterais volontiers, et avec une vigeur qu’elle ne soupçonne pas, mon écritoire à la face. Voilà ce qu’elle me dit aujourd’hui, cette vilaine Ame, qui n’est pas une hallucination: ‚En vérité, les poëtes sont de singuliers fous de prétendre que l’imagination soit nécessaire dans toutes les fonctions de l’art. Qu’est-il besoin d’imagination, par exemple, pour faire un portrait? Pour peindre mon âme, mon âme si visible, si claire, si notoire? Je pose, et en réalité c’est moi, le modèle, qui consens à faire le gros de la besogne. Je suis le véritable fournisseur de l’artiste. Je suis, à moi tout seul, toute la matière.‘ Mais je lui réponds: ‚ Caput mortuum , tais-toi! Brute hyperboréenne des anciens jours, éternel Esquimau porte-lunettes, ou plutôt porte-écailles, que toutes les visions de Damas, tous les tonnerres et les éclairs ne sauraient éclairer! plus la matière est, en apparence, positive et solide, et plus la besogne de l’imagination est subtile et laborieuse. Un portrait! Quoi de plus simple et de plus compliqué, de plus évident et de plus profond?‘3
Zentraler Diskussionspunkt ist also die Frage der Imagination in ihrer Notwendigkeit für die Kunst im Allgemeinen, für das Porträt im Besonderen. Das verhasste bürgerliche Gegenüber ist seinerseits ein imaginiertes, aber kein halluziniertes, wie Baudelaire betont: fiktional, aber (leider) nicht fiktiv. Es sitzt ihm nah („cellule“) gegenüber („en face“) – eigentlich selbst schon eine Konstellation des verzerrten Spiegelporträts. Das bürgerliche Gegenüber behauptet sich in seiner positivistischen Materialität, die den Künstler geradezu überflüssig macht: Wozu Imagination, wenn doch alles sichtbar ist? Baudelaire nimmt diese Selbstreduktion auf die ‚Sache‘ in seiner erwidernden Beschimpfung als caput mortuum auf – der Totenschädel dient hier als Symbol irreduzibler Materialität. Kein Blitz der Welt reiche jemals aus, um diese kieselbebrillte, hintereisbergische Seele zu erhellen und sie zur Einsicht in die tatsächlichen Verhältnisse zu bringen: je sichtbarer die ‚positive‘ und ‚solide‘ Materie zu sein scheint, desto subtiler und notwendiger ist die Arbeit der Imagination. Das Portrait ist einfach und kompliziert, evident und tiefgründig zugleich, so die pointierte Antithese Baudelaires.
Читать дальше