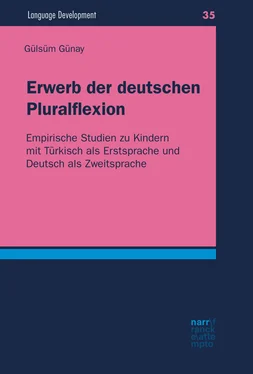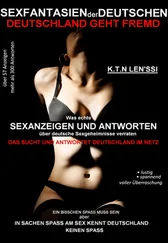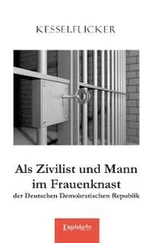Gegen diese eher strukturalistischen Ansätze versucht Köpcke (1993) eine Regelformulierung, die „um eine psychologische Komponente erweitert [… ist], in deren Mittelpunkt der Sprachbenutzer mit seiner allgemeinen kognitiven Ausstattung steht, aufgrund derer er dazu befähigt ist, eine Art sekundäre Ordnung in das scheinbare Chaos zu bringen“ (Köpcke 1993: 20). Trotz einiger Unterschiede, wie z.B. der Annahme, dass es im Deutschen acht (vgl. Köpcke 1993: 35) und nicht neun Pluralallomorphe gibt, wie oft in der Literatur aufgeführt (siehe z.B. Ramge 1975, Werner 1969: 93, Nübling 2002: 98, Mac Whinney 1994: 302, Christen 2000: 199)3, geht auch Köpcke in erster Linie von den bisher dargestellten Annahmen aus. Der entscheidende Unterschied beruht auf seiner Fokussierung des Sprecherverhaltens (vgl. Köpcke 1993: 37). Regelmäßigkeiten in der Pluralbildung könnten zwar formuliert werden, würden jedoch kaum dafür genutzt werden können, um Feststellungen über das Sprecherverhalten, wie es in der Wirklichkeit abläuft, zu konzipieren. Bereits Mugdans Ergebnisse von 1977, in denen er feststellt, dass „15 Regeln und 21 Listen von Ausnahmen benötigt [werden], um die Pluralzuweisung zu allen nominalen Lexemen des Deutschen erklären zu können“ (Köpcke 1993: 38), würden zeigen, dass eine alleinige Formulierung von Regeln nicht ausreiche. Die zahlreichen Auflistungen von Ausnahmen deuten darauf hin, so Köpcke, dass außer der Regelaufstellung die Bildung eines weiteren Konzeptes für die Erklärung der Pluralmarkierungszuweisungen notwendig sei, und zwar das Konzept der „Schemata“ (Köpcke 1993: 82). Der Sprecher bildet in seinem mentalen Lexikon verschiedene, mit unterschiedlichen Strukturen gekennzeichnete, Schemata. Die Kennzeichnung gehe aus der so genannten „Signalstärke“ hervor, die sich aus verschiedenen Kategorien der Wahrnehmung zusammensetze. Das heißt, dass der Sprecher bei der Zuweisung von Pluralmarkierungen auf Schemata zurückgreift, die er in seinem mentalen Lexikon durch vorherige Wahrnehmungen bildet. Dieses Konzept soll an dieser Stelle nicht ausführlicher behandelt werden, da es in Kapitel 5.1 eingehender thematisiert wird. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Köpcke davon ausgeht, dass die Markierung des Plurals eher produktorientiert nach „abstrakten Schemata“ (Köpcke 1993: 86) im mentalen Lexikon erfolgt und weniger mit durch Regeln entstandene Morphembildungen zu erklären ist. Wie bereits angedeutet, spielt die Silbenstruktur der Nomen ebenfalls eine Rolle bei der Pluralmarkierung. Es kann festgestellt werden, dass einsilbige Wortstämme bei der Pluralbildung in zweisilbige Pluralformen umgewandelt werden, die einen Trochäus mit finaler Schwa-Silbe aufweisen: (23) Schuh → Schuhe Mehrsilbige Wörter enden bei der Pluralform ebenfalls auf einen Trochäus: (24) Elefant → Elefanten Nahezu keine Regelaufstellung erfolgt, ohne dass Ausnahmen formuliert werden. Die einzige Regel, die bei allen Systematisierungsbestrebungen auftaucht und deren Gültigkeit immer gegeben ist, ist die Regel, dass für Feminina mit Schwa als Auslaut immer ein -nsuffigiert wird (vgl. Sonnenstuhl-Henning 2003: 94): (25) die Birne → die Birnen In den nächsten Kapiteln soll nun das Genussystem und anschließend das Kasussystem des Deutschen skizziert werden. 2.2 Das Genussystem des Deutschen Die Merkmalklasse Genus weist im Deutschen die Merkmale Femininum, Maskulinum und Neutrum auf und ist „nomeninhärent“, das heißt für jedes Nomen „festgelegt“ (Weber 2001: 11). Sind Gesetzmäßigkeiten bei dieser Festlegung erkennbar? Inwieweit sind diese Gesetze gültig? Können sie überhaupt als Gesetze formuliert werden? Welche Funktionen hat das Genus im Deutschen und wo und wie wird es markiert? Die differenzierende Markierung beim Genus in feminin, maskulin und neutrum erfolgt nur im Singular und es wird „an sprachlichen Einheiten markiert, die gemeinsam mit dem Nomen auftreten: an indefiniten und definiten Artikeln, Determinativen1 und Adjektiven.“ (Montanari 2010: 194): def. Artikel indef. Artikel Adjektiv Fem. die Nase eine Nase eine groß e Nase Mask. der Mund ein Mund ein groß er Mund Neutr. das Auge ein Auge ein groß es Auge Tabelle 2: Genusmarkierung im Deutschen (im Nominativ Singular) Außer den in Tabelle 2 aufgeführten Markierungen kann das Genus an weiteren „das Nomen begleitenden Wortarten ausgedrückt werden“ (Wegener 1995b: 97), wie z.B. den Pronomen (siehe dazu Montanari 2010: 195).2 In der Tabelle sind außerdem lediglich die Genusmarkierungen im Nominativ Singular aufgelistet, zu den Änderungen der einzelnen Markierungen in den jeweiligen Phrasenelementen je nach Kasus sei an dieser Stelle auf Montanari (ebd.) verwiesen. Im Plural besitzen Artikelwörter und Adjektive keine besonderen Genusformen, das heißt „alle drei Kategorien fallen in einer einzigen Form zusammen“ (Marouani 2006: 16). Die Markierung erfolgt im Plural ausschließlich ohne Genusdifferenzierung: Artikel Adjektiv Artikel und Adjektiv Fem. die Nasen groß e Nasen die groß en Nasen Mask. die Münder groß e Münder die groß en Münder Neutr. die Augen groß e Augen die groß en Augen Tabelle 3: Genusmarkierung im Deutschen (im Nominativ Plural) Dabei existiert sowohl im Singular als auch im Plural eine besondere Beziehung zwischen dem Artikel, dem Adjektiv und dem Nomen – Eisenberg spricht von einer „syntagmatischen Bindung“ (Eisenberg 2000a: 91). Diese Beziehung wird als Kongruenz bezeichnet und stellt die „flexivische Anpassung der zusammengehörigen Satzteile“ (Weber 2001: 11) dar. Nach Corbett (2006) spielen bei der Kongruenz Verknüpfungen auf den syntaktischen, semantischen, morphologischen und lexikalischen Ebenen eine Rolle. Diese Beziehung ist „keine symmetrische Relation, sondern die Beziehung einer Entität zu einer zweiten, auf die die erste einwirkt“ (Montanari 2010: 181). Durch dieses Aufeinanderwirken wird ihre Zusammengehörigkeit deutlich. Dabei stellt im Falle der Genusmarkierung im Deutschen das Nomen die Merkmalquelle dar, da es die Merkmale der anderen Bezugselemente bestimmt und vorgibt. Nach welchen Kriterien erfolgt diese Vorgabe? Die Beschäftigung mit dieser Frage und die unterschiedlichen Auffassungen über ihre Beantwortung führen zu der Annahme, dass es sich bei der „Genuszuweisung [… um] eines der undurchsichtigsten Kapitel der deutschen Grammatik“ (Wegener 1995e: 1) handelt und führt sogar soweit, dass das Genus „zu den […] umstrittensten Kategorien innerhalb der Sprachwissenschaft“ (Schwarze 2008: 182) gezählt wird. Während die „Analogisten“ (Fischer 2004: 30) die Gesetzmäßigkeiten in den Vordergrund stellen, betonen die „Anomalisten“ (ebd.) die Willkürlichkeit bei der Zuweisung des Genus an die Nomen. Oft ist von Genuszuweisungsprinzipien die Rede, da „neben produktiven“ Regeln, die formuliert werden, „andere mit beschränkter Produktivität stehen“ (Köpcke/Zubin 1997: 87). Nicht nur Weber (2001) stellt in ihrer Analyse wichtiger deutscher Grammatiken fest, dass das Genus darin oft unzureichend thematisiert wird (siehe dazu auch Heringer 1995: 203). Aufgrund der unterschiedlichen produktiven Regeln, die oft auch für nur eine bestimmte Gruppe von Nomen gelten, werden diese Regeln nicht als Regeln betrachtet und es herrscht bei der Betrachtung des Genus im Deutschen, wie in diesen Grammatiken ersichtlich wird, eine gewisse Unsicherheit (vgl. Weber 2001: 90). Ein Blick in die aktuelle Genusforschung zeigt, dass eine Reihe von Regeln und Prinzipien erkennbar sind. Listen von Genuszuweisungsregeln werden u.a. von Köpcke (1982) und Wegener (1995a) formuliert. Eine differenzierende Zusammenstellung der wichtigsten Kriterien und Kategorien ist in Montanari (2010: 196–208) zu finden. Nach Heringer (1995: 212) sind diese festgestellten Regeln „nach drei Kriterien zu beurteilen: Reichweite, Validität und Stärke“. Wie groß ist die Anzahl der Nomen, für die diese Regel gilt? Mit der Beantwortung dieser Frage wird die „Reichweite“ der Regel bestimmt.
Читать дальше