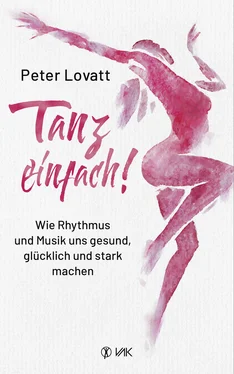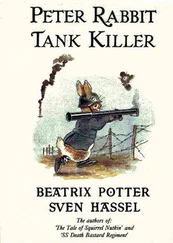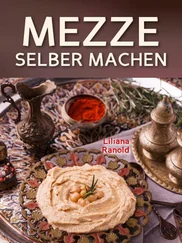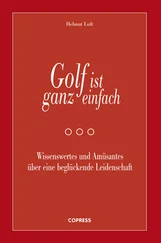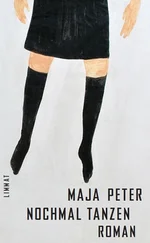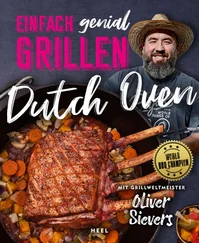Ich schrieb mich an einer Abendschule ein, um auf ein A-Level in Psychologie zu lernen. Dazu musste ich meinen Beruf als professioneller Tänzer aufgeben, denn ich musste ein Jahr fest an einem Ort bleiben und konnte nicht abends arbeiten. Zweimal wöchentlich hatte ich abends Unterricht. Nebenher bewarb ich mich offiziell um einen Studienplatz. Dazwischen übernahm ich Gelegenheitsjobs als Auslieferungsfahrer. So war es gut; alles lief nach Plan. Und dann erhielt ich im Winter im Laufe weniger Wochen von allen fünf Universitäten, an denen ich mich beworben hatte, eine Ablehnung. Das war ein Schlag. Ein wirklich schwerer. Manchester, Sheffield, das University College London, Bristol und Durham, alle sagten nein. Als die fünfte Ablehnung kam, wollte ich alles hinschmeißen. Ich ging nicht mehr zur Abendschule und fragte mich, was um alles in der Welt ich da bloß angestellt hatte: Ich hatte eine Karriere als Tänzer aufgegeben, das einzige, worin ich gut war, das Einzige, was sich für mich natürlich anfühlte, um zur Universität zu gehen – und ich hatte keinen Studienplatz bekommen.
In dieser Zeit begann ich eine Beziehung zu einem Mädchen namens Lindsey, die ich an der Abendschule kennengelernt hatte. Auch sie plante einen Berufswechsel und brauchte ein A-Level in Psychologie, um zur Uni gehen zu können. Sie war von der Universität ihrer Wahl angenommen worden, und schaffte die Schule spielend. Ich hatte mehr als die Hälfte verpasst, aber durch viel gutes Zureden konnte Lindsey mich überzeugen, in den letzten paar Schulwochen doch wiederzukommen und die Prüfung abzulegen. Einen Monat lang lernten wir jeden Abend zusammen. Das war das Beste, was ich tun konnte, und zwar aus zwei Gründen: Erstens habe ich die Prüfung geschafft, mit Ach und Krach zwar, aber es genügte, um mich im akademischen Spiel zu halten; zweitens habe ich Lindsey ein paar Monate später geheiratet und seither ist sie meine Lebenspartnerin.
Von nun an ging ich bei meiner Studienplatzsuche strategischer vor. Ich besuchte mehrere psychologische Fakultäten und traf mich mit verschiedenen Zulassungs-Tutoren. Zum Glück machte mir eines der Colleges ein bedingungsloses Angebot, und im September 1990 trat ich am Froebel College in Roehampton meine akademische Reise an. Der Campus des Froebel College war wunderschön, und es kam mir vor, als wäre ich abgeholt und in der Zeit zurückversetzt worden. Während meiner drei Jahre dort entwickelte ich eine Begeisterung für Neurobiologie und Neuropsychologie. Diese Fächer beschäftigen sich mit Untersuchungen des biologischen Aufbaus des Gehirns und der Frage, was mit Menschen geschieht, wenn ihr Gehirn geschädigt wird.
Tanz und Psychologie waren damals streng getrennte Bereiche meines Lebens. Ich lernte Psychologie im Labor und tanzte im Studio und trat in Theaterstücken und Shows auf. Aber ich wusste, dass ich keine Ausbildung zum Tanztherapeuten machen wollte. Meine Eltern hatten beide in einem Krankenhaus gearbeitet, und ich wusste, dass dies nicht die richtige Umgebung für mich wäre. Ich wollte etwas anderes, wusste aber nicht, was.
1993 machte ich in Roehampton meinen Abschluss und nahm dank eines staatlichen Stipendiums am Centre for Cognitive and Computational Neurosciences der Universität Stirling ein Master-Studium in Neuroinformatik auf. Die Neuroinformatik erstellt mithilfe von Mathematik und künstlichen Netzwerken Modelle des Gehirns während des Verarbeitungsprozesses. Wir waren eine kleine, zusammengewürfelte Kohorte von Studentinnen und Studenten aus Informatik, Physik, Mathematik und Psychologie, und unser Ziel war es herauszufinden, wie wir plausible Modelle des Gehirns erstellen und diesen dann „Gehirnschäden“ zufügen konnten, um zu lernen, wie das Gehirn sich erholt. Das war ehrgeizig. Mathematik fand ich zunächst verwirrend. Die Vorlesungen konnten aus Folie um Folie voller mathematischer Formeln bestehen, die aus scheinbar Hunderten griechischer Symbole zusammengesetzt waren. Meine Abende verbrachte ich damit, die Symbole für Theta, Delta, Lambda (das ich für eine Schauspielschule gehalten hatte) unterscheiden und benennen zu lernen. Es war ein anspruchsvoller Studiengang, und die meisten Studierenden waren superintelligente Introvertierte, die seitenlange mathematische Beweise verinnerlichen konnten, ohne etwas aufschreiben zu müssen, genau wie ich mir lange Tanznummern. Mit Infinitesimalrechnung und Algebra hatte ich zu kämpfen, aber am Ende kam ich durch und wechselte von Stirling an die Universität Essex, wo ich mit einem Stipendium ein Promotionsstudium in experimenteller Kognitionspsychologie aufnahm. Die Kognitionspsychologie beschäftigt sich damit, wie Menschen denken, lernen, Probleme lösen, Sprache gebrauchen, die Welt wahrnehmen und erinnern. Experimentelle Kognitionspsychologie ist mit sehr viel Laborarbeit verbunden. Ich habe drei Jahre in einem sehr kleinen Labor zugebracht und gemessen, wie lange Menschen brauchen, um Wortlisten zu lesen, und welche Wörter sie sich anschließend am besten merken können. Ich versuchte zu verstehen, wie Menschen lernen und erinnern, mit dem Ziel, geeignete Reha-Programme für Patientinnen und Patienten mit Hirnschäden zu entwickeln, insbesondere wenn Gedächtnis und Sprachzentrum beeinträchtigt waren.
Nach Abschluss meiner Promotion übernahm ich eine Post-Doktorandenstelle am Forschungszentrum für Englisch und Angewandte Linguistik an der englischen Fakultät der Universität Cambridge. Als Tänzer war ich es gewohnt, für Engagements vorzutanzen, wobei Hunderte hoffnungsvoller Menschen in vielen aufeinanderfolgenden Tanzduellen aussortiert werden, aber so etwas wie mein Vorstellungsgespräch in Cambridge hatte ich noch nicht erlebt. Ein zweitägiger Prozess an einer der ältesten und angesehensten Universitäten der Welt – die für mich zugleich der magische Ort am Ende des Regenbogens war, von dem ich in den letzten sieben Jahren geträumt hatte.
An der Universität Cambridge arbeitete ich als Psychologe an einem Projekt, bei dem untersucht wurde, wie Menschen mehr als eine Sprache lernen. Mich interessierte, wie Menschen in verschiedenen Sprachen „denken“, und wie sie Wörter abspeichern und erinnern, die in verschiedenen Sprachen dieselbe oder unterschiedliche Bedeutung haben; und auch, wie sie neue (fremdsprachige) Wörter lesen und ihnen einen Sinn geben sowie dann komplexe linguistische Muster verstehen lernen. Darüber hinaus entwickelte ich Interesse an der Beziehung zwischen Legasthenie und Gedächtnis. Zum ersten Mal las ich Näheres über einige der Probleme, die Menschen mit Legasthenie beim Sehen, Codieren und Erinnern von Wörtern haben. Die Beschreibungen, die ich in der Literatur fand, hätten von mir und meinen Schwierigkeiten beim Lesen handeln können: die Schwierigkeit, „Ausnahme“-Wörter zu lesen (das heißt, Wörter, deren Klang nicht mit ihrer Schreibweise übereinstimmt); die Schwierigkeit, sich zu merken, welche Wörter in einem sehr langen Satz zusammengehören; und die Schwierigkeit, sich in großen Textblöcken auf einzelne Wörter zu konzentrieren. Dass ich nun etwas über die kognitiven Modelle dieser Leseschwierigkeiten erfuhr, half mir zu verstehen, warum mir das Lesen so schwergefallen war und wie ich diese Schwierigkeiten hatte überwinden können.
Meine Zeit als akademischer Psychologe an der Universität Cambridge markierte das Ende einer sehr langen Reise. Zehn Jahre hatte ich gebraucht, und nun hatte ich einen Bachelor, einen Master und einen Doktor in Psychologie. Ich kam mir vor, als hätte ich den Gipfel des Mount Everest erreicht. Also tat ich genau das, was alle Menschen tun, sobald sie auf dem Gipfel eines Berges angekommen sind: Ich drehte mich um und ging wieder hinunter. Nach zwei Jahren verließ ich Cambridge und fing an zu planen, wie ich mein Fachwissen in Psychologie mit dem Thema verbinden konnte, das mir das liebste auf der Welt war, Tanzen. Das Ergebnis war das Dance Psychology Lab.
Читать дальше