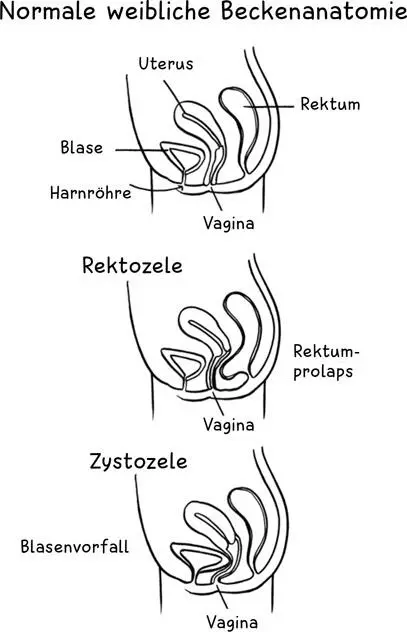Ich denke nur: „MEINE VERDAMMTE GEBÄRMUTTER FÄLLT AUS MIR HERAUS.“
„Was führt sonst noch dazu, dass Urin abgeht?“, fragt sie mich, während ich unbeholfen von der Liege klettere und einen weiteren Schwall Urin verliere.
Und dann erinnere ich mich an das Schlimmste. Irgendwo in der verschwommenen Welt der Vorbereitungskurse, Gespräche mit Freunden und vorsichtigen Fragen in Online-Foren habe ich den Eindruck gewonnen, man sollte vor der Sechs-Wochen-Untersuchung Sex haben, um herauszufinden, ob alles ohne Probleme funktioniert. In Wahrheit ist das kein so großartiger Tipp, vor allem deswegen, weil wir alle anders sind und die Ärztinnen und Ärzte schon wissen, was zu tun ist. Aber ich wollte einfach nur normal sein. Mein Mann ist von Natur aus ebenfalls fügsam. Beide haben wir in der Grundschule die Milch verteilt und wir halten uns an Regeln. Außerdem hatte der Quickie, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist, spaßig geklungen, als wir im Geburtsvorbereitungskurs Witze darüber gerissen hatten. Als wir noch dachten, dass wir für alle Eventualitäten vorgesorgt hätten.
Natürlich haben wir uns brav an die Empfehlung gehalten. Auf dem Treppenabsatz, im Halbdunkel, mit jeder Menge Kissen und überschaubarer Romantik. Unser Schlafzimmer war von unserem schlafenden Baby in Beschlag genommen. Soll ich ihr erzählen, dass es auch dabei passiert ist? Oder ist das selbst für eine Ärztin zu viel Information? Ich traue ihr schon zu, sich das anzuhören – schließlich redet sie tagtäglich über gedehnte und eingerissene Genitalien (was für ein Job!). Ich weiß nur nicht, ob ich das packe.
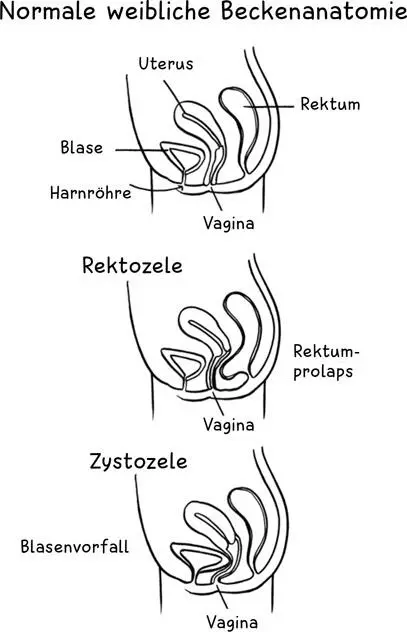
Ich nehme all meinen Mut zusammen und beschließe, mich nicht mehr zurückzuhalten und mich ganz zu zeigen. Unsere Augen treffen sich.
„Ich mache mir bei allem in die Hose, bei einfach allem“, höre ich mich sagen, und meine Stimme klingt blechern und trotzig zugleich.
Sie nickt, um anzudeuten, dass Mitgefühl angebracht ist, auch wenn sie es nicht geben kann. Wir haben beide keine Zeit dafür, dass ich noch einmal in Tränen ausbreche. Vielleicht höre ich dann nie wieder auf. Sie nimmt den Stift in die Hand und fängt an zu planen.
„Sie brauchen auf jeden Fall schnellstmöglich einen Termin bei den Physiotherapeutinnen hier“, sagt sie. „Ich stelle die Überweisung gleich aus.“
Ich starre sie fassungslos an. Ich kann nicht noch einmal hierherkommen. Auf gar keinen Fall. Das würde sich anfühlen wie Tod oder Folter. Ich werde in der Eingangshalle hyperventilierend zusammenbrechen.
„Man kann da heutzutage schon viel machen“, sagt sie. „Machen Sie sich keine Sorgen, wirklich.“ Wahrscheinlich denkt sie, ich würde mich schämen.
„Das ist es nicht. Ich …“
„Es gibt Kurse im Übungsraum …“
ES GIBT KURSE? IN EINER ART TURNHALLE? Wir pinkeln uns alle zusammen in die Hose? Wir sind die Übriggebliebenen von der Resterampe, die niemand in seiner Mannschaft haben will? Meine Panik erreicht einen neuen Höhepunkt. Ich bin inkontinent und ich muss zurück in die Turnhalle?
„… aber ich denke, in Ihrem Fall ist ein Einzeltraining wohl besser.“
Ist es das?
Mein Sohn quäkt. Ich sehe seine Zehen unter der gelben Decke herauslugen. Umwerfend. Zum Anknabbern. Meins.
Ich muss fast lächeln. Ich bin tapfer. Ich kann das alles für ihn durchstehen, für uns. Ich kann es zumindest versuchen.
„Die Kolleginnen hier sind wirklich kompetent.“
Ich schließe die Augen, doch ich kann ihren Blick durch meine geschlossenen Lider wahrnehmen. Sie versucht einzuschätzen, wie aufgelöst ich bin.
„Ich glaube, sie brauchen vielleicht auch eine Traumatherapie“, fügt sie hinzu und greift nach einem weiteren Überweisungsblatt.
Sie glaubt?
Dieser Tag, an dem mir klar wurde, dass mein Problem über seltene „Hoppla“-Momente hinausging, hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Ein Jahr später schrieb ich einer Freundin:
„Ich schätze mal, es wird ganz nett auf der Isle Of Wight, aber ich bin ein wenig nervös, weil – und ich weiß, dass das Unsinn ist –, wir genau das auch letztes Jahr gemacht haben, und der damalige Donnerstag war einer der schrecklichsten Tage meines Lebens.“
Wahrscheinlich ist das gar nicht so überraschend. Eine Diagnose wirft einen immer aus der Bahn, selbst wenn man schon länger geahnt hat, dass irgendetwas nicht stimmt.
Donnerstag, Ende August 2007, auf dem Weg zum Baby-Kino und einem Ausflug
Als mein Sohn und ich auf den riesigen, ächzenden Klinikaufzug warten, fühle ich mich irgendwie beraubt. Bestraft für meine Ehrlichkeit. Mein Herz auszuschütten, hat mir gerade einen Bonus an Schmach gebracht. Physiotherapie. Traumatherapie.
Nach drei Treppen und einer Gebärmutter, die irgendwo auf Höhe meiner Knöchel zu hängen scheint, bin ich am Kino angelangt und schaue mir in der Baby-Vorstellung Das Bourne Ultimatum an. Ich weine, als Paddy Considine erschossen wird und störe mich an der fehlenden Hintergrundgeschichte von Jason Bourne. Mein Sohn liebt das Spiel von Licht und Schatten und lächelt zum ersten Mal richtig, als Matt Damon jemanden zusammenschlägt. Vielleicht übt es auf ihn eine ebenso befreiende Wirkung aus wie auf mich.
Ich schaue mir die attraktiven und adretten jungen Mütter um mich herum an. In meinem klebrigen T-Shirt (Milch) und mit feuchtem Hintern (Pipi) habe ich das Gefühl, dass mir etwas fehlt. Erst später wird mir bewusst, dass es Nannys sind, eine ganz andere Spezies. „Wahrscheinlich hatten sie heute Morgen sogar Zeit, sich die Zähne zu putzen“, denke ich. Das waren die goldenen Zeiten.
Und dann treten wir unsere Reise auf die Isle of Wight an: drei Stunden Fahrt, eine Fähre und als Zugabe noch eine Kettenfähre. Kein Problem. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich es geschafft habe. Mein Vater holt mich und meinen Sohn zu Hause ab und wir machen es uns auf dem Rücksitz bequem. Das Baby weint. Es hört nur damit auf, wenn wir schneller als 100 km/h fahren. Damit wird die Stunde im stockenden Verkehr wegen Bauarbeiten hinter London zu einer komischen Variante von Speed, nur dass ich weder Keanu Reeves noch Sandra Bullock küsse, sondern mich in den Sicherheitsgurten halb stranguliere, als ich versuche, meinen Sohn in seinem Kindersitz zu stillen, während er vor Wut explodiert.
Meine chaotischen ersten Wochen der Mutterschaft erreichen einen Höhepunkt, als wir das Schiff verpassen. Wir hören noch das Klappern der sich schließenden Tore und sehen, wie die majestätische Fähre ablegt. Mein Vater macht etwas unglaublich Nettes. Er kauft mir ein Ticket für eine Personenfähre und sorgt dafür, dass meine Mutter mich und das Baby auf der anderen Seite abholt, während er auf die nächste Autofähre wartet. Das Wasser erscheint im Dunklen wie ein solider schwarzer Block. Aber ihm haftet noch die Erinnerung des sommerlichen Glanzes an, des Schimmers eines Abends am Meer, wenn der Sand noch warm ist und die Sonnenanbeter sich verzogen haben. Ihm fehlt das Beißende des Winters. Es ist groß und weit und glänzend genug, um mich in eine ruhige Stimmung zu versetzen.
Ich lasse den Tag Revue passieren und klammere mich an der ersten Einschätzung der Ärztin fest, dass zwar großer Mist passiert ist, ich aber wahrscheinlich nicht depressiv bin. Ihre Bemerkung über das Trauma habe ich bereits vergessen. Ich bin unendlich erschöpft. Meine Mutter serviert mir warmes Krebsfleisch. Ich bin heute zu viel herumgelaufen, um noch eine gute Gesprächspartnerin zu sein, habe zu viel geredet und in die Hose gemacht und mich erinnert. Zu viel Angst wirft mich aus der Bahn wie eine Art schwammiger Kopfschmerz.
Читать дальше