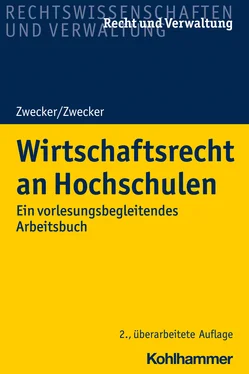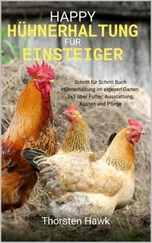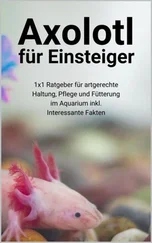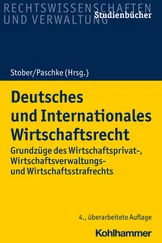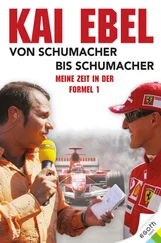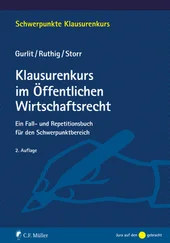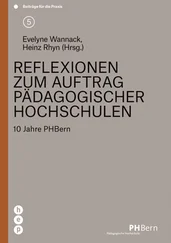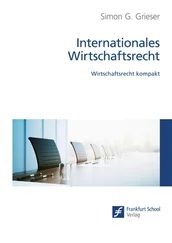2) Weitere Voraussetzung ist eine Pflichtverletzung des A
Definition:
Bei einem Kaufvertrag ist der Verkäufer einer Sache gemäß § 433 Abs. 1 BGB verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Erfüllt er diese Verpflichtung nicht, liegt eine Pflichtverletzung vor (auch § 283 BGB).
Sachverhaltsprüfung:
Im vorliegenden Fall hat A das Auto während seines Urlaubs an C übergeben und übereignet. Er kann daher seine Verpflichtung aus dem Kaufvertrag mit B nicht mehr erfüllen (§ 275 Abs. 1 BGB). Hierdurch hat A eine Pflichtverletzung im Sinne von § 280 Abs. 1 BGB begangen.
3) Weiterhin muss durch die Pflichtverletzung ein Schaden entstanden sein
Definition:
Ein Schaden ist jede unfreiwillige Einbuße an Vermögenswerten. Nach § 249 Abs. 1 BGB muss der zum Schadenersatz Verpflichtete den Zustand herstellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. Ein Schaden besteht also in der Differenz zwischen der Ist-Situation und der Situation, die ohne die Pflichtverletzung bestehen würde (sogenannte Differenzhypothese).
Sachverhaltsprüfung:
Die Ist-Situation gestaltet sich so, dass B zwar den Kaufpreis von 20.000 € nicht bezahlt hat, jedoch hat er auch den Pkw im Wert von 29.000 € nicht erhalten. Ohne die Pflichtverletzung hätte B den Pkw im Wert von 29.000 € erhalten und hierfür 20.000 € an A gezahlt. Die Differenz in Höhe von 9.000 € stellt den Schaden des B dar.
4) Schließlich ist nach § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB erforderlich, dass A den Schaden zu vertreten hat
Definition:
Im Rahmen eines Schuldverhältnisses muss der Schuldner nach § 276 BGB Vorsatz und Fahrlässigkeit vertreten. Vorsatz bedeutet, dass der Schuldner die Pflichtverletzung mit Wissen und Wollen begangen hat. Fahrlässig handelt der Schuldner hingegen gemäß § 276 Abs. 2 BGB, wenn er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt.
Sachverhaltsprüfung:
Im vorliegenden Fall hätte A überprüfen müssen, ob B innerhalb der von ihm gesetzten Annahmefrist bis zum 31.03. das Angebot angenommen hat. Da er dies nicht getan hat, handelte er zumindest fahrlässig.
4.Folgerungen und Ergebnis
27Haben Sie im Rahmen der Subsumtion festgestellt, dass alle erforderlichen Tatbestandsvoraussetzungen der Anspruchsgrundlage erfüllt sind, können Sie feststellen, dass die geprüfte Rechtsfolgeeintritt.
Fortsetzung der Lösung zu Fallbeispiel 2:
Die Voraussetzungen des § 280 BGB sind im vorliegenden Fall insgesamt erfüllt, daher kann B von A Schadenersatz in Höhe von 9.000 € verlangen.
28Sind einzelne oder alle Tatbestandsvoraussetzungen nicht erfüllt, stellen Sie im Ergebnis fest, dass die Anspruchsgrundlage das Anspruchsbegehren nicht trägt.
5.Gegenrechte des Anspruchsgegners
29Haben Sie das Bestehen eines Anspruchs positiv festgestellt, müssen sie unter Umständen noch prüfen, ob Gegenrechtedes Anspruchsgegners bestehen. Solche Gegenrechte können Einwendungenoder Einredensein. Der bereits entstandene Anspruch fällt bei solchen Gegenrechten entweder nachträglich weg (Einwendungen) oder der Anspruch besteht zwar (noch), kann aber nicht durchgesetzt (= gerichtlich geltend gemacht) werden (Einreden).
Einwendungenvernichten den Anspruch oder lassen ihn gar nicht erst entstehen.
Beispiel:Rücktritt vom Vertrag (§§ 346 ff. BGB), Erfüllung (§§ 362 ff. BGB), Hinterlegung (§§ 372 ff. BGB), Aufrechnung (§§ 387 ff. BGB), Erlass (§ 397 BGB), …
30 Einredenhingegen vernichten den Anspruch zwar nicht, sie führen jedoch dazu, dass der Anspruchsgegner zumindest zeitweise das Recht hat, die Leistung zu verweigern (sogenannte Leistungsverweigerungsrechte).
Beispiel:Verjährung des Anspruchs (§ 214 BGB), Zurückbehaltungsrechte (§§ 273, 320 BGB), mangelnde Fälligkeit (§ 271 BGB), …
Fortsetzung der Lösung zu Fallbeispiel 2:
Wenn B dem A bspw. aus einem Darlehensvertrag noch 9.000 € schuldet, kann A gegen den Anspruch des B auf Schadenersatz nach § 388 BGB die sogenannte Aufrechnung erklären. In diesem Fall erlischt nach § 389 BGB der Schadenersatzanspruch des B mit Erklärung der Aufrechnung. Gegen den Anspruch besteht dann eine Einwendung.
Macht B den Anspruch erst 4 Jahre nach dem Zeitpunkt geltend, an dem er erfahren hat, dass A den Pkw an C verkauft hat, so wäre der Anspruch verjährt, da die Verjährungsfrist von drei Jahren (§ 195 BGB) nach § 199 Abs. 1 BGB mit dem Zeitpunkt beginnt, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger (hier also B) von den anspruchsbegründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt hat. Konsequenz wäre, dass A nach § 214 Abs. 1 BGB berechtigt wäre, die Leistung (Zahlung von Schadenersatz) zu verweigern. Hier bestünde eine dauerhafte Einrede gegen den Schadenersatzanspruch.
II.Darstellung in der Klausur
31Für Sie ist nun wichtig, wie Sie die dargestellten fünf Schritte der juristischen Fallbearbeitung in Ihrer Klausur anwenden können. Das Vorgehen ist nachfolgend dargestellt.
Schritt 1: Anspruchsgrundlage
32Die Darstellung der dargestellten Arbeitsschritte in der Falllösung und Klausur erfolgt im sogenannten „Gutachtenstil“. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass die Obersätze im Konjunktiv formuliert werden. Dies liegt daran, dass zu Beginn der Prüfung noch nicht klar ist, ob der begehrte Anspruch tatsächlich besteht oder nicht.
In der Einleitung (Obersatz) sind grundsätzlich
– Anspruchsteller (Wer?),
– Anspruchsziel (Was?),
– Anspruchsgegner (Von wem?) und
– Anspruchsgrundlage (Woraus?)
darzustellen.
Beachten Sie:
Als Hilfestellung in der Klausur sollten Sie sich bei der Fallbearbeitung immer die Frage stellen:
„Wer will was von wem woraus?“
Fortsetzung der Lösung zu Fallbeispiel 2:
Wenden wir diese Frage nun auf unser Fallbeispiel an, lautet der Obersatz für die Fallbearbeitung:
– „B (Anspruchssteller = Wer?)
– könnte einen Anspruch auf Schadenersatz (Anspruchsziel = Was?)
– gegen A (Anspruchsgegner = Von wem?)
– aus § 280 Abs. 1 BGB (Anspruchsgrundlage = Woraus?) haben.“
Schritt 2: Tatbestandsvoraussetzungen
33Die Darstellung der Tatbestandsvoraussetzungen können Sie als Stereotyp mit dem Satz „Voraussetzung hierfür ist …“ einleiten.
Fortsetzung der Lösung zu Fallbeispiel 2:
Wenden wir dies auf die vier vorab definierten Tatbestandsmerkmale des § 280 Abs. 1 BGB an, ergibt sich bspw. folgende Formulierung:
Voraussetzung hierfür ist
(1) das Vorliegen eines Schuldverhältnisses zwischen A und B,
(2) eine Pflichtverletzung des A und,
(3) dass bei B ein Schaden eingetreten ist.
(4) Weiterhin muss A die Pflichtverletzung zu vertreten haben.
Schritt 3: Subsumtion
34Wenn Sie nach der Definition des jeweiligen Tatbestandsmerkmals die konkrete Sachverhaltsprüfung vornehmen, können Sie diese mit der Formulierung: „im vorliegenden Fall …“ einleiten. Eine ausführlichere Diskussion können Sie mit der Wendung: „fraglich ist …“ beginnen.
Beachten Sie:
Insbesondere bei den Definitionen der Tatbestandsvoraussetzungen sollten Sie großen Wert auf sprachliche Präzision legen. Viele Formulierungen des Gesetzes sind abstrakt und nicht mehr unbedingt den heutigen Sprachgebräuchen entsprechend. Dies liegt daran, dass das BGB bspw. in seiner Grundform aus dem Jahr 1900 stammt und dann im Laufe der Jahre erweitert und ergänzt wurde.
Читать дальше