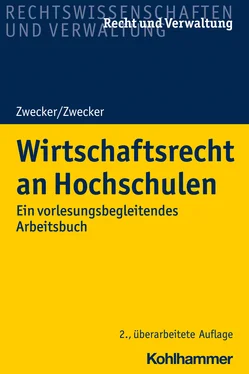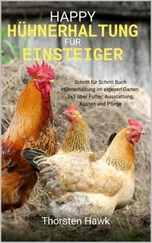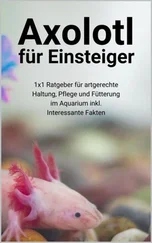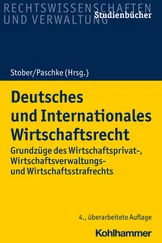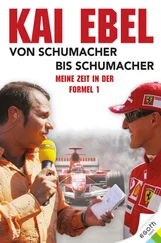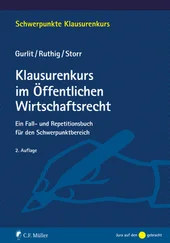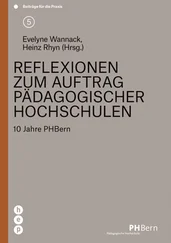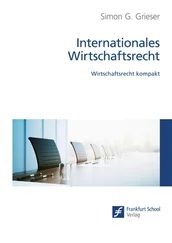1 ...7 8 9 11 12 13 ...17 54Aufgrund der Privatautonomie und des fehlenden Typenzwangs bei Schuldverhältnissen sind diese Regelungen nicht abschließend, es handelt sich vielmehr um Regelungen von Schuldverhältnissen, die in der Praxis besonders häufig vorkommen. An dieser Stelle seien die wichtigsten Schuldverhältnisse aufgeführt. Diese lassen sich wie folgt unterteilen:
– Veräußerungsverträge:
– Kaufvertrag §§ 433 ff. BGB,
– Tauschvertrag § 480 BGB,
– Schenkungsvertrag §§ 516 ff. BGB,
– Gebrauchsüberlassungsverträge:
– Mietvertrag §§ 553 ff. BGB,
– Pachtvertrag §§ 581 ff. BGB,
– Leihe § 598 BGB,
– Sachdarlehen § 607 BGB,
– Leistungen von Diensten und Herstellung von Werken:
– Dienstvertrag §§ 611 ff. BGB,
– Werkvertrag §§ 631 ff. BGB,
– Architekten- und Ingenieurvertrag §§ 650p ff. BGB,
– Bauträgervertrag §§ 650u f. BGB,
– Pauschalreisevertrag §§ 651a ff. BGB,
– Geschäftsbesorgungsvertrag §§ 675 ff. BGB,
– Erbringung von Zahlungsdiensten §§ 675c ff. BGB,
– Behandlungsvertrag § 630a BGB,
– Sichernde Verträge:
– Bürgschaft §§ 665 ff. BGB,
– Vergleichsvertrag § 779 BGB,
– Anerkenntnis § 781 BGB,
– Ungerechtfertigte Bereicherung §§ 812 ff. BGB,
– Geschäftsführung ohne Auftrag §§ 677 ff. BGB,
– Unerlaubte Handlung §§ 823 ff. BGB.
Beachten Sie:
Im Schuldrecht haben immer die Vorschriften des Besonderen Teils Vorrangvor den Vorschriften des Allgemeinen Teils. Das heißt für Sie für die Bearbeitung von Fällen in der Klausur, dass Sie bei jedem Schuldverhältnis immer zuerst prüfen müssen, ob die Vorschriften des Besonderen Teils eine Regelung zu dem jeweiligen Problem enthalten, bevor Sie nach den einschlägigen Normen im Allgemeinen Teil suchen.
Beispiel:A schenkt B ein Handy. Der Schenker A haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit (§ 521 BGB). Diese Vorschrift des Besonderen Teils verdrängt die allgemeine Norm des § 276 Abs. 1 Satz 1 BGB aus dem Allgemeinen Teil, wonach A Vorsatz und jede Fahrlässigkeit (also auch einfache Fahrlässigkeit) zu vertreten hätte.
Andererseits verweisen Vorschriften des Besonderen Teils häufig auf Normen aus dem Allgemeinen Teil zurück, in dem einige Regelungen quasi „vor die Klammer gezogen“ sind.
Beispiel:
– § 437 Nr. 2, 3 BGB verweist für die kaufrechtliche Gewährleistung auf die allgemeinen Vorschriften des Rücktritts- (§§ 323, 326 Abs. 5 BGB) und Schadenersatzrechts (§§ 280, 281, 283, 311a BGB),
– § 634 Nr. 3, 4 BGB verweisen für die werkvertragliche Gewährleistung auf allgemeine Vorschriften.
2. Kapitel:Vertragliche Schuldverhältnisse
I.Entstehung vertraglicher Schuldverhältnisse
55 Warum ist das Thema für Sie von Bedeutung:
Die Regelungen zur Entstehung vertraglicher Schuldverhältnisse spielen in der Praxis eine erhebliche Rolle. So bestimmt bspw. der Zeitpunkt des Vertragsschlusses, welche Leistungen die Parteien einander schulden, also den konkreten Vertragsinhalt. Oft ist dieser Zeitpunkt schwer zu bestimmen. Stellen sie sich vor, Sie arbeiten als Vertriebsmitarbeiter bei einer Softwareentwicklungsfirma. Eines Tages erhalten Sie die Anfrage eines Kunden, ob sie ein Projekt mit bestimmten Leistungsparametern ausführen können. Sie besprechen dies mit Ihrer Technikabteilung und machen dann dem Kunden ein bestimmtes Angebot, allerdings mit leicht veränderten Leistungsparametern. Der Kunde modifiziert die Leistungsparameter wieder und sendet Ihnen eine „Annahme“ Ihres Angebotes. Daraufhin versenden Sie eine Auftragsbestätigung, in der Sie wieder die ursprünglichen Leistungsparameter Ihres Angebots zugrunde legen. Kurze Zeit später erhalten Sie eine weitere Auftragsbestätigung des Kunden, in der er wieder seine Leistungsparameter zugrunde gelegt hat. Daraufhin beginnt Ihre Firma mit den Arbeiten. Später kommt es zu Streitigkeiten, bei denen die Frage entscheidend ist, welche Leistungsparameter Ihre Firma nunmehr genau schuldet. Bereits dieses alltägliche Beispiel zeigt die Bedeutung der Frage, wann und mit welchem Inhalt ein Vertrag zustande kommt.
Fallbeispiel 3 (Lösung s. Rn. 63, 153, 168, 169, 174, 273):
Die Firma X GmbH bietet in ihrem Webshop Notebooks zum Verkauf an. Das Geschäftsmodell der X GmbH besteht darin, dass sich der Kunde das Notebook (Gehäuse, Festplatte, Grafikkarte, Soundkarte etc.) selbst zusammenstellen kann. Nach der Bestellung des Kunden wird das Notebook dann aus den entsprechenden Teilen zusammengesetzt und ausgeliefert. A will sich ein Notebook bestellen und konfiguriert dies auf der Website der X GmbH aus den entsprechenden Bauteilen. Er klickt den Computer in seinen Warenkorb und geht dann auf die Seite „Bestellen“. Dort füllt er das Bestellformular aus. Dieses enthält den Hinweis, dass für alle Bestellungen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der X GmbH gelten. Bevor er auf den Bestellbutton gelangt, muss A die Allgemeinen Geschäftsbedingungen „durchscrollen“. Dort ist zu lesen:
„Die Lieferung erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.“
Unmittelbar nachdem A auf „Bestellen“ geklickt hat, erhält er eine automatisierte E-Mail, in der ihm die Lieferung bestätigt wird. Das Gerät wird bereits 3 Tage später per Nachnahme geliefert. A lässt das Notebook zunächst liegen, da er beruflich für längere Zeit auf Geschäftsreise muss. Als er einen Monat später zurückkommt und das Notebook installiert, stellt er fest, dass sich das Notebook nicht starten lässt. Er wendet sich an die X GmbH, die ihm mitteilt, dass man aufgrund des Gewährleistungsausschlusses nichts mehr für A tun könne. A schreibt daraufhin an die X GmbH, dass er vom Vertrag zurücktrete und die Rückzahlung seines Kaufpreises in Höhe von 1.599 € verlange.
Beurteilen Sie, ob A die gezahlten 1.599 € zurückbekommt. Gehen Sie hierbei davon aus, dass die X GmbH alle gesetzlich erforderlichen Belehrungen ordnungsgemäß erteilt hat.
II.Vertragsschluss und Willenserklärung
56Verträge sind Rechtsgeschäfte, die aus zwei (oder mehr) sich deckenden, also übereinstimmenden, Willenserklärungender Vertragspartner bestehen. Diese Willenserklärungen heißen Angebot (Antrag) und Annahme. Hierbei kommt ein Vertrag aber erst zustande, wenn sich die Parteien über den notwendigen Vertragsinhalt einigen. Notwendiger Vertragsinhaltsind in der Regel Leistungund Gegenleistungder Parteien.
Beispiel:A bietet dem B sein Fahrrad zum Verkauf an. B erklärt, er sei damit einverstanden. Hier haben sich die Parteien zwar geeinigt, jedoch nur über die Leistung und nicht über die Gegenleistung. Ein Kaufvertrag ist damit noch nicht zustande gekommen. Erst wenn A und B sich auch über den Kaufpreis geeinigt haben, liegen zwei übereinstimmende Willenserklärungen über den notwendigen Vertragsinhalt (Leistung und Gegenleistung) vor.
57Nicht jede Willensäußerung stellt auch eine Willenserklärungim rechtlichen Sinn dar. Willenserklärungen im rechtlichen Sinn sind nur solche Willensäußerungen, die auf einen rechtlichen Erfolggerichtet sind. Damit eine solche Willenserklärung angenommen werden kann, muss der Erklärende
– Handlungswillen,
– Erklärungsbewusstsein (Rechtsbindungswille) und
– Geschäftswillen gehabt haben.
Der Handlungswillebeschreibt hierbei den Willen, überhaupt etwas zu äußern, das Erklärungsbewusstseinbeschreibt den Willen, etwas rechtlich Erhebliches zu erklären und der Geschäftswilleden Willen, eine konkrete Rechtsfolge herbeizuführen.
Читать дальше