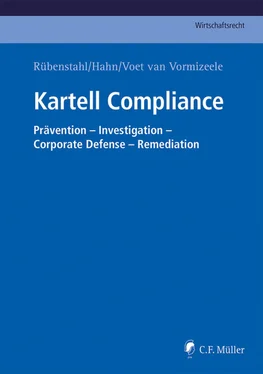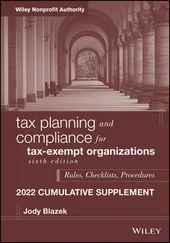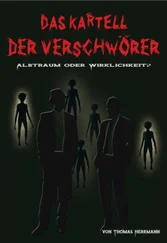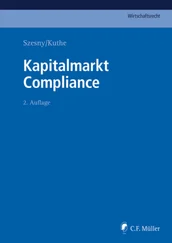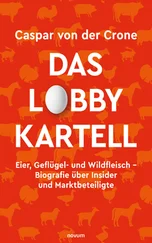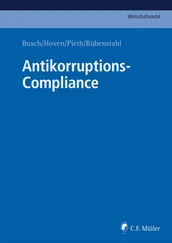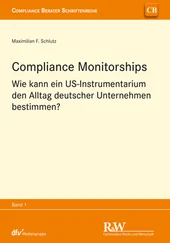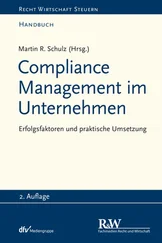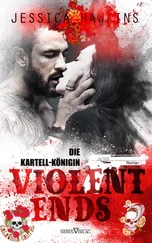Weitere wichtige Faktoren bei der Marktbeherrschungsprüfung sind die Finanzkraft der neuen Unternehmenseinheit, ihr Zugang zu den Beschaffungs- und Absatzmärkten, bestehende Verflechtungen mit anderen Unternehmen, das Vorhandensein von rechtlichen oder tatsächlichen Schranken für den Marktzutritt anderer Unternehmen, der tatsächliche oder potentielle Wettbewerb durch ausländische und inländische Unternehmen, die Fähigkeit der neuen Unternehmenseinheit ihr Angebot oder ihre Nachfrage auf andere Waren bzw. Dienstleistungen umzustellen sowie die Möglichkeit der Marktgegenseite, auf andere Unternehmen auszuweichen (vgl. § 18 Abs. 3 GWB).[107] Welche Bedeutung diesen einzelnen Kriterien zukommt, die jeweils für sich genommen keine beherrschende Stellung begründen können, hängt stets von den konkreten Umständen ab. Im Einzelfall kann zudem auch dem aktuellen Marktverhalten der Unternehmen eine gewisse Indizwirkung zukommen.[108] Marktbeherrschung ist auch auf der Nachfrageseite eines Marktes möglich, wenn die Anbieter von bestimmten Waren oder Dienstleistungen auf ein Unternehmen als Abnehmer angewiesen sind und dieses daher über einen unkontrollierten Verhaltensspielraum verfügt.[109]
3. Oligopolmarktbeherrschung
83
Nach der Oligopolklausel des § 18 Abs. 5 GWB können auch mehrere Unternehmen zusammen marktbeherrschend sein, wobei in diesem Fall jedes Mitglied des Oligopols für sich marktbeherrschend ist. Voraussetzung hierfür ist, dass zwischen den Unternehmen der Oligopol-Gruppe im Innenverhältnis kein wesentlicher (Binnen-)Wettbewerb besteht und sie zusammen im Außenverhältnis über eine marktbeherrschende Stellung gegenüber Außenseitern verfügen. In der Praxis bereitet vor allem die Beurteilung des Binnenwettbewerbs zwischen den Oligopolisten Probleme. Nach der Rechtsprechung fehlt es hieran, wenn aufgrund einer wertenden Gesamtbetrachtung nach der Marktstruktur mit einem dauerhaft einheitlichen Verhalten der Oligopolmitglieder zu rechnen ist, weil dies aufgrund der Merkmale des relevanten Marktes wirtschaftlich vernünftig ist, insbesondere bei einer engen Reaktionsverbundenheit durch Markttransparenz und wirksame Abschreckungs- und Vergeltungsmittel gegen wettbewerbliche Vorstöße eines Oligopolisten in Abweichung von dem einheitlichen Verhalten, und wenn kein nennenswerter Wettbewerb zwischen den Oligopolisten beobachtet werden kann.[110] Die für diese Prüfung heranzuziehenden Kriterien, wie etwa Symmetrie der Marktanteile, Markttransparenz, Produkthomogenität und Verflechtungen, entsprechen denen, die die Kommission bei der Prüfung auf koordinierte Wirkungen anwendet, so dass hierauf verwiesen werden kann.
4. Marktbeherrschungsvermutungen
84
Anders als das europäische Recht enthält das GWB Vermutungstatbestände für die Einzel- und die Oligopolmarktbeherrschung, um dem Bundeskartellamt die Praxis der Fusionskontrolle zu erleichtern. Ein Unternehmen ist danach als allein marktbeherrschend anzusehen, wenn es einen Marktanteil von mindestens 40 % hat (§ 18 Abs. 4 GWB). Eine Gesamtheit von Unternehmen gilt als marktbeherrschend, wenn sie aus drei oder weniger Unternehmen besteht, die zusammen einen Marktanteil von 50 % erreichen (§ 18 Abs. 6 Nr. 1 GWB), oder aus fünf oder weniger Unternehmen besteht, die zusammen einen Marktanteil von zwei Dritteln erreichen (§ 18 Abs. 6 Nr. 2 GWB). Das Bundeskartellamt ist beim Eingreifen der Vermutungen allerdings nicht von einer umfassenden Prüfung der Untersagungsvoraussetzungen entbunden, sondern muss in jedem Fall sämtliche für und gegen die Marktbeherrschung sprechenden Umstände von Amts wegen ermitteln. Lediglich dann, wenn nach einer solch umfassenden Prüfung eine marktbeherrschende Stellung weder nachgewiesen ist noch ausgeschlossen werden kann, ist Raum für die Anwendung der Vermutungen.[111] Die Unternehmen können der ihnen danach obliegenden materiellen Beweislast durch eine Widerlegung der Vermutung nachkommen. Die Einzelmarktbeherrschungsvermutung lässt sich z.B. durch den Nachweis heftigen Preiswettbewerbs, das Fehlen von Marktzutrittsschranken, technische Neuerungen oder marktmächtige Nachfrager widerlegen. Die beiden Oligopolvermutungen begründen demgegenüber eine echte Beweislastumkehr, da die am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen nachweisen müssen, dass die Wettbewerbsbedingungen auch nach dem Zusammenschluss zwischen ihnen wesentlichen Wettbewerb erwarten lassen oder das Oligopol im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern keine überragende Marktstellung hat (§ 18 Abs. 7 GWB).[112]
5. Begründung oder Verstärkung von Marktbeherrschung
85
Das Bundeskartellamt kann einen Zusammenschluss nur dann untersagen, wenn hierdurch eine marktbeherrschende Stellung begründet oder verstärkt wird. Die Marktstellung der beteiligten Unternehmen muss sich also durch den Zusammenschluss zum Nachteil der Wettbewerbsverhältnisse verschlechtern. Um dies festzustellen bedarf es eines Vergleichs der Wettbewerbsbedingungen mit und ohne den Zusammenschluss. Die Begründung einer marktbeherrschenden Stellung setzt voraus, dass eine solche vor dem Zusammenschluss noch nicht bestanden hat. Dies erfordert eine wesentliche und nachhaltige Veränderung der Marktstruktur und einen erheblichen Marktanteilszuwachs, was in der Praxis eher selten vorkommt. Häufiger sind Fälle, in denen eine bereits bestehende Marktbeherrschung weiter verstärkt wird, d.h. sich die Größen, die die Marktmacht nach § 18 Abs. 3 GWB bestimmen, dergestalt ändern, dass die die Macht neutralisierende Wirkung des Wettbewerbs in noch höherem Maße eingeschränkt wird, als dies vor dem Zusammenschluss der Fall war.[113] Eine Verstärkungswirkung ist dabei vor allem beim Zuwachs von Marktanteilen beim marktbeherrschenden Unternehmen anzunehmen. Dabei ist der Restwettbewerb auf einem Markt umso schutzwürdiger, je größer die schon bestehende Marktmacht der beteiligten Unternehmen ist, so dass auf hochkonzentrierten Märkten bereits ein geringfügiger Marktanteilsgewinn von 1 % für eine Verstärkung ausreichen kann.[114] Ein Zuwachs an Marktanteilen ist jedoch keine zwingende Voraussetzung. Vielmehr reicht es bereits aus, wenn die Unternehmen durch den Zusammenschluss den nachstoßenden Wettbewerb der Konkurrenten abmindern können, indem sie die aktuellen Wettbewerber durch einen Ressourcenzuwachs von aggressivem Wettbewerbsverhalten abschrecken oder potentielle Konkurrenten von einem Marktzutritt abhalten.[115]
Der Zusammenschluss muss für die Veränderung der Marktstruktur schließlich auch ursächlich sein. An der Kausalität fehlt es insbesondere bei einem Zusammenschluss mit einem vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch stehenden Unternehmen, wenn das sanierungsbedürftige Unternehmen ohne den Zusammenschluss aus dem Markt ausscheiden müsste und seine Marktanteile dann ebenfalls dem erwerbenden Unternehmen zugefallen wären (sog. Sanierungsfusion).[116]
86
Nach § 36 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 GWB darf das Bundeskartellamt einen Zusammenschluss der die Eingriffsvoraussetzungen erfüllt dann nicht untersagen, wenn hierdurch auch Verbesserungen der Wettbewerbsbedingungen eintreten und diese Verbesserungen die Behinderung des Wettbewerbs überwiegen. Diese sog. Abwägungsklausel eröffnet dem Bundeskartellamt die Möglichkeit, die positiven und negativen Aspekte eines Zusammenschlusses gegeneinander abzuwägen und bei einem Überwiegen der positiven Aspekte auf ein Verbot des Zusammenschlusses zu verzichten. Allerdings sind hierbei allein positive strukturelle Veränderungen auf anderen Märkten berücksichtigungsfähig, nicht dagegen solche Vorteile, die allein bei den beteiligten Unternehmen eintreten (z.B. durch Rationalisierung) oder von gesamtwirtschaftlicher Bedeutung sind (z.B. Vorteile für den Arbeitsmarkt).[117] Lässt sich die Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen mit weniger einschneidenden Mitteln erreichen, so greift die Abwägungsklausel nicht ein. Der Nachweis für das Eintreten der Verbesserung, deren Überwiegen über die Nachteile und die Kausalität durch den Zusammenschluss obliegt den beteiligten Unternehmen. Deshalb und aufgrund der restriktiven Handhabung durch das Bundeskartellamt hat die Abwägungsklausel in der Praxis keine große Bedeutung.
Читать дальше