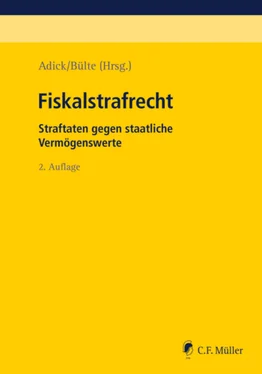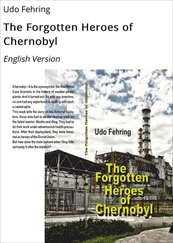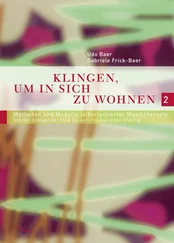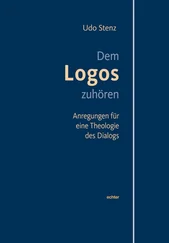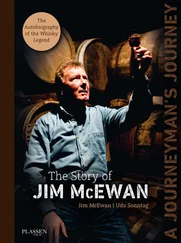56
Im Rahmen der Hauptverhandlung und bei Vernehmungen durch den beauftragten oder ersuchten Richter darf der Vertreter der BuStra nach § 407 Abs. 1 S. 5 AO unmittelbar Fragenan den Angeklagten, Zeugen und Sachverständigen richten (§ 240 Abs. 2 S. 1 StPO, Nr. 94 Abs. 3 S. 2 AStBV). Das Gericht wird die Notwendigkeit oder Sachdienlichkeit der Frage i.d.R. nicht überprüfen, ggf. aber von der Zurückweisungsmöglichkeit ungeeigneter oder nicht zur Sache gehörender Fragen durch den Vorsitzenden nach § 241 Abs. 2 StPO Gebrauch machen.
57
Ebenso steht der FinB in der Hauptverhandlung sowie bei der Vernehmung durch den beauftragten oder ersuchten Richter ein Stellungnahme- oder Erklärungsrecht nach § 407 Abs. 1 S. 4 AOzu (vgl. auch Nr. 94 Abs. 2 S. 2 AStBV). Der Vertreter der FinB erhält nach dem Wortlaut auf Verlangendas Wort. Es obliegt jedoch dem Vorsitzenden aufgrund seiner Prozessleitungsbefugnis nach § 238 StPO, den Zeitpunkt der Stellungnahme zu bestimmen. In der Praxis ist die besondere Sachkunde des BuStra-Mitarbeiters bzw. des SGL der BuStra für sämtliche Verfahrensbeteiligte durchaus förderlich, so dass es eines förmlichen Antrags auf Worterteilung i.d.R. nicht bedarf und erfahrungsgemäß sehr frühzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird. Dieses Stellungnahme- oder Erklärungsrecht entspricht inhaltlich nichtdem Schlussvortragder StA nach § 258 StPO und sollte diesen auch nicht vorwegnehmen. Denn § 258 Abs. 1 StPO räumt dieses Recht lediglich der StA, dem Angeklagten bzw. dem Verteidiger, dem Privatkläger (vgl. §§ 374 ff. StPO) und Einziehungsbeteiligten § 427 Abs. 1 StPO sowie über § 397 Abs. 1 S. 3 StPO auch dem Nebenkläger ein.[2] Die FinB ist weder Nebenkläger noch hat sie ein Recht auf Erwiderung gem. § 258 Abs. 2 StPO.[3] Der Vertreter der FinB kann zu dem Schlussvortrag der StA noch ergänzende Ausführungen machen, jedoch darf er keine eigenen Anträge stellen (vgl. hierzu Nr. 94 Abs. 3 S. 3 AStBV). Ebenso wenig kann er Beweisanträge stellen oder Rechtsmittel einlegen (vgl. Nr. 94 Abs. 3 S. 3, Nr. 95 AStBV).[4]
58
Der Vertreter der BuStrakann auch als Zeuge oder Sachverständigervernommen werden.[5] Es liegt im Ermessen des Gerichts bzw. Vorsitzenden dem auch als Zeugen geladenen Vertreter der BuStra, die Teilnahme an der Hauptverhandlung von Beginn an zu gestatten.[6] Die Vertreter der FinB erhalten von ihrem Dienstvorgesetzten für diese Fälle eine Aussagegenehmigung gem. § 54 StPO. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn der BuStra-Mitarbeiter an den Ermittlungen beteiligt war und nunmehr als Sachverständiger vernommen werden soll, da die Möglichkeit der Ablehnung gem. § 74 StPO eröffnet ist.
59
Die FinB ist nach § 407 Abs. 2 AO von dem Urteil oder anderer verfahrensabschließender Entscheidungen in Kenntnis zu setzen. Unabhängig davon, ob die FinB in der Hauptverhandlung anwesend war oder nicht, erhält sie eine Ausfertigung des Urteils oder Einstellungsbeschlusses nach Nr. 9 Abs. 1 i.V.m. Nr. 4 Abs. 3 Nr. 2 MiStra.
60
Verstöße gegen die Beteiligungsrechteder FinB nach § 407 Abs. 1 AO sind lediglich mit einer formlosen Gegenvorstellung angreifbar.[7] Ungeachtet der weiteren, aber streitigen Möglichkeit der Dienstaufsichtsbeschwerde, sind beide Formen des Rechtsschutzes erfahrungsgemäß wenig Erfolg versprechend.[8] Seitens der StA (theoretisch auch seitens des Angeklagten) bestünde allenfalls die Möglichkeit, die Verletzung der Beteiligungsrechte nach § 407 Abs. 1 AO im Rahmen der Aufklärungsrüge nach § 344 Abs. 2 i.V.m. § 244 Abs. 2 StPO mit der Revision geltend zu machen, wenn sich im konkreten Fall die Beteiligung der FinB aufgedrängt hätte und durch die Wahrnehmung der Rechte eine weitere Sachaufklärung zu erwarten gewesen wäre.[9]
[1]
Meyer-Goßner/ Schmitt § 160 b Rn. 3.
[2]
Meyer-Goßner/ Schmitt § 258 Rn. 4 ff.
[3]
Meyer-Goßner/ Schmitt § 258 Rn. 18, § 397 Rn. 10.
[4]
Hübschmann/Hepp/Spitaler/ Tormöhlen § 407 Rn. 34; Franzen/Gast/ Joecks § 407 Rn. 9.
[5]
Franzen/Gast/ Joecks § 407 Rn. 15 f.; Kohlmann/ Hilgers-Klautzch § 407 Rn. 8.
[6]
LG Dresden NJW 1998, 3509 f.
[7]
Kohlmann/ Hilgers-Klautzsch § 407 Rn. 22; Hübschmann/Hepp/Spitaler/ Tormöhlen § 407 Rn. 36.
[8]
Franzen/Gast/ Joecks § 407 Rn. 20.
[9]
BayObLG NStZ-RR 1996, 145 f.; Hübschmann/Hepp/Spitaler/ Tormöhlen § 407 Rn. 38.
4. Kapitel Verfahren bei Steuerdelikten› VII. Besonderheiten bei Steuerstrafverfahren
VII. Besonderheiten bei Steuerstrafverfahren
61
Die im Folgenden dargestellten Besonderheiten im Steuerstrafverfahren orientieren sich an der Praxis und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
4. Kapitel Verfahren bei Steuerdelikten› VII. Besonderheiten bei Steuerstrafverfahren› 1. Besteuerungsverfahren und Steuerstrafverfahren
1. Besteuerungsverfahren und Steuerstrafverfahren
62
Neben der Doppelfunktion der Steufa (vgl. Rn. 4, 7 f.), dem Durchsichtsrecht der Papiere des von der Durchsuchung Betroffenen nach § 404 S. 2 AO (vgl. Rn. 64), der Verteidigerstellung des Steuerberaters (vgl. Rn. 36), dem Wegfall des Erstbefragungsrechts (vgl. Rn. 10), der unmittelbaren Anforderung von Bankauskünften durch die Steufa (vgl. Rn. 13) sowie der Ermittlungsmöglichkeit der FinB im gesamten Bundesgebiet (vgl. Rn. 12) ist eine weitere Besonderheit im Steuerstrafverfahren, dass das Besteuerungsverfahren und das Strafverfahren parallel nebeneinanderweiterlaufen (vgl. Nr. 16 AStBV). In beiden Verfahren hat der Beschuldigte unterschiedliche Rechte und Pflichten (§ 393 Abs. 1 S. 1 AO). Im Besteuerungsverfahren ist der Beschuldigte nach Einleitung des Strafverfahrens gem. § 90 AO weiterhin zur Mitwirkung verpflichtet. Dies steht dem im Strafverfahren geltenden Nemo-tenetur-Prinzip, wonach sich niemand selbst belasten muss, entgegen. Nach § 393 Abs. 1 S. 2 AO ist der Beschuldigte trotz des laufenden Ermittlungsverfahrens weiterhin zur Mitwirkung verpflichtet, jedoch können keine Zwangsmittel gem. §§ 328 ff. AO(Zwangsgeld, Ersatzvornahme und unmittelbarer Zwang) eingesetzt werden, wenn die Mitwirkung zu einer Selbstbelastung führen würde. Dies führt im Ergebnis dazu, dass der Beschuldigte zwar tatsächlich ein Mitwirkungs- oder Auskunftsverweigerungsrechthat, aber die ggf. nachteilige steuerrechtliche Folge der Schätzung gem. § 162 AO hinnehmen muss.[1]
63
Nachdem dem Steuerpflichtigen die Einleitung eines Steuerstrafverfahrens bekannt gegeben wurde, wird eine wegen des Verdachts eines Steuerdelikts unterbrochene BP fortgesetzt, die nicht selten wegen des oben unter Rn. 62beschriebenen Dilemmas mit einer im Besteuerungsverfahren ungünstigen Hinzuschätzung gem. § 162 AO endet.[2] In einem Steuerstrafverfahren ist eine Schätzung von Besteuerungsgrundlagen zulässig, wenn feststeht, dass der Steuerpflichtige einen Besteuerungstatbestand erfüllt hat, die tatsächlichen Besteuerungsgrundlagen aber ungewiss sind.[3] Eine Schätzungdarf jedoch in keinem Fall Sanktionscharakteraufweisen. Eine Hinzuschätzung mit Sanktionscharakter ist wegen der dem Beschuldigten zustehenden Mitwirkungsverweigerung unzulässig.[4] Schätzungen müssen sachgerecht und angemessen sein, d.h. sie müssen den wahrscheinlichsten Besteuerungstatbestand widerspiegeln. Eine pauschale Schätzung, auch unter Heranziehung der Richtwerte für Rohgewinnaufschlagsätze aus der Richtsatzsammlung des Bundesministeriums der Finanzen,[5] kann erst dann Anwendung finden, wenn sich eine konkrete Ermittlung oder Schätzung der tatsächlichen Umsätze von vorneherein oder nach entsprechenden (darzulegenden) Berechnungsversuchen als nicht möglich und fehlerbehaftet erweist.[6] Nach Anforderung der Rspr. müssen aber auch bei dieser Schätzungsmethode die festgestellten Umstände des Einzelfalles mit in den Blick genommen werden. Ein Tatgericht muss sich bei der Beweiswürdigung zum Rohgewinnaufschlagsatz einerseits nicht zugunsten des Angeklagten an den unteren Werten der Richtsatzsammlung orientieren, wenn es Anhaltspunkte für eine positivere Ertragslage zu erkennen vermag.[7]Andererseits darf das Tatgericht bei verbleibenden Zweifeln nicht einfach einen als wahrscheinlich angesehenen Wert aus der Richtsatzsammlung zugrunde legen, sondern muss einen als erwiesen angesehenen Mindestschuldumfang feststellen.[8]
Читать дальше