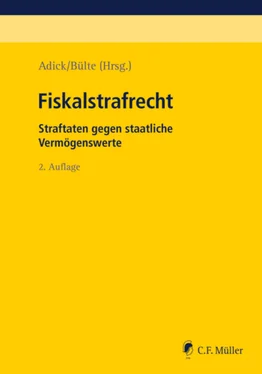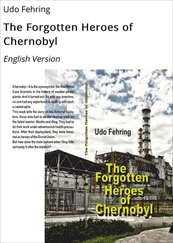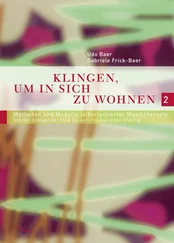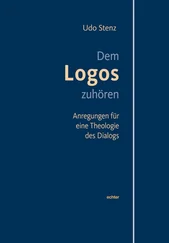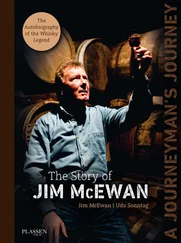79
Den maßgeblichen rechtlichen Rahmen bildet hier das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG. Es schützt im Wesentlichen vor der öffentlichen Preisgabe der Identität des Beschuldigten bzw. Angeklagten. Grundsätzlich unzulässig ist daher die Abbildung oder Nennung des Vor- und Zunamens. Auch sonstige individualisierende Umstände sind vom Schutzbereich des Grundrechts erfasst. Im Rahmen der sog. praktischen Konkordanz, d.h. der Abwägung von Persönlichkeitsrecht und öffentlichem Interesse an der Berichterstattung bzw. Information über das Verfahren oder die Person des Betroffenen tritt das Individualinteresse zurück, sobald es sich bei dem Betroffenen um eine Person der Zeitgeschichtehandelt. Entscheidend für die hier vorzunehmende Güterabwägung ist die Bedeutung der angenommenen Straftat für die Bevölkerung oder auch ihre Beispielhaftigkeit für gesellschaftliche Entwicklungen.[3] Selbstverständlich entfallen diese Einschränkungen, wenn der Betroffene selbst öffentlich Stellung zu dem Tatvorwurf bezieht oder er zuvor sein Einverständnis erteilt.
80
Den Medien sind in ihrer Berichterstattung ansonsten grds. nur wenige Grenzen gesetzt. Die sog. Verdachtsberichterstattungist ein aus Art. 5 Abs. 1 GG abgeleitetes Privileg. Voraussetzung ist, dass der in Rede stehende Vorgang von Bedeutung ist, die Umstände eingehend geprüft wurden und der Sachverhalt objektiv und unter Mitteilung der entlastenden Umstände veröffentlicht wird.[4] Jedenfalls ist der Unschuldsvermutungund dem Verbot einer Vorverurteilung Rechnung zu tragen.
81
Im Falle einer einseitig geführten Berichterstattung kann die Abgabe einer Presseerklärung ein probates Mittel sein, um Fehlentwicklungen oder eine Verzerrung des maßgeblichen Sachverhalts zu vermeiden. Hierdurch kann häufig verhindert werden, dass der Betroffene sich durch seine Aussagen selbst zum Beweismittel macht.[5] Bei einer eindeutigen Diskreditierung des Betroffenen können zudem presserechtliche Gegenmaßnahmen erwogen werden. Neben Schadensersatzansprüchen kommen hier vor allem Berichtigungsansprüche oder jedenfalls Unterlassungsansprüche in Betracht.[6] Konkret kommen Ansprüche aus §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB i.V.m. dem allgemeinem Persönlichkeitsrecht nach Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG und § 22 KunstUrhG in Frage. Letztlich kommt die Erstattung eines Strafantrages wegen Verleumdung und Beleidigung (§§ 185, 186 StGB) in Betracht.
b) Strafrechtliche Nebenfolgen
82
Gem. § 45 StGB treffen den Verurteilten neben der Freiheits- oder Geldstrafe unter Umständen auch sog. Nebenfolgen. Folgende Statusfolgenkommen in Betracht:
83
Amtsverlust, Verlust des passiven Wahlrechts und Verlust des aktiven Wahlrechts. Der Verlust kann dabei in zwei Formen erfolgen. Zum einen tritt der Verlust gem. § 45 Abs. 1 StGB automatisch kraft Gesetzes ein, wenn der Täter wegen eines Verbrechens, sei es auch nur der Versuch, die Teilnahme oder strafbare Vorbereitung, zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wird. Im Falle einer Gesamtstrafe kommt es darauf an, dass eine Einzelstrafe wegen eines Verbrechens diese Höhe erreicht. Der Verlust dauert vorbehaltlich der Wiederverleihung von Fähigkeiten und Rechten gem. § 45b StGB fünf Jahre.[7] Zum anderen kann der Status gerichtlich aberkannt werden und die Nebenfolge vom Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen für die Dauer von zwei bis fünf Jahren verhängt werden, § 45 Abs. 2, 5 StGB. Die Aberkennung kommt immer nur neben einer Mindeststrafe von sechs Monaten beziehungsweise einem Jahr in Betracht. Dabei ist sie auch zulässig, wenn die Mindeststrafe als Gesamtstrafe verhängt wird.[8] Dem Verlust des aktiven und passiven Wahlrechts kommt allerdings – im Gegensatz zum Amtsverlust – kaum praktische Bedeutung zu.
84
Wird jemand wegen einer Straftat unter Missbrauch seiner beruflichen oder gewerblichen Stellung oder unter grober Verletzung seiner beruflichen Pflichten verurteilt, kann – unabhängig von den möglichen berufsrechtlichen Folgen – gem. § 70 StGB bereits im Strafverfahren ein Berufsverbot angeordnet werden.
c) Beamtenrechtliche Folgen
85
Das Beamtenverhältnisendet schon bei Verurteilung wegen eines vorsätzlichen Vergehens zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr, § 48 BBG, mit den in § 49 BBG beschriebenen Folgen.
d) Berufsgerichtliche Verfahren
86
In Verfahren gegen Angehörige bestimmter Berufe (s.o.) wie etwa dem Beamten oder Steuerberater hat die Staatsanwaltschaft Mitteilung zu machen. Die Regelungen hierfür finden sich in den §§ 12 ff. EGGVG und den Gesetzen, die den konkreten Berufszweig betreffen (z.B. § 10 Abs. 2 StBerG). Die jeweiligen Mitteilungspflichtensind der MiStra zu entnehmen. Insbesondere in Wirtschaftsstrafsachen sind zumeist Mitglieder der Berufe des Wirtschaftsprüfers, des vereidigten Buchprüfers, des Steuerberaters, oder bestimmte Angehörige einer Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- oder Buchprüfungsgesellschaft, Inhaber und Geschäftsleiter von Kredit- und Finanzdienstleistern, Wertpapierdienstleistungs- oder Versicherungsunternehmen, Gewerbetreibende, Rechtsanwälte oder Beamte betroffen. Mitzuteilen ist der Erlass eines Haftbefehls, die das Verfahren abschließende Entscheidung, oder der sonstige Verfahrensausgang, so auch das rechtskräftige Urteil. Die Mitteilungspflichten sind den Nr. 15, 23–25b, 39 MiStra zu entnehmen.[9]
e) Gewerberechtliche Folgen
87
Das Gewerbezentralregister (GZR) wird beim Bundesamt für Justiz als besondere Abteilung des Bundeszentralregisters geführt. Es enthält neben Verwaltungsentscheidungen auch Bußgeldentscheidungen wegen im Zusammenhang mit der Gewerbeausübung begangener Ordnungswidrigkeiten(vorausgesetzt, dass das festgesetzte Bußgeld 200 € übersteigt) sowie bestimmte rechtskräftige strafgerichtliche Verurteilungen gegen Gewerbetreibende. Die Eintragung wird im Rahmen von Zuverlässigkeitsprüfungen im Gewerbe- und Gaststättenrecht relevant, wenn die zuständigen Ämter Auskunft aus dem GZR nach § 150a GewO verlangen. Die Gewerbeuntersagungrichtet sich hierbei nach § 35 GewO. Das Gewerbe wird nach § 35 GewO untersagt, wenn die zuständige Behörde zu dem Ergebnis kommt, dass der Gewerbetreibende unzuverlässig ist und die Untersagung zum Schutz der Allgemeinheit oder der im Betrieb Beschäftigten erforderlich ist. Will eine Verwaltungsbehörde in dem Untersagungsverfahren einen Sachverhalt berücksichtigen, der Gegenstand der Urteilsfindung in einem Strafverfahren gegen einen Gewerbetreibenden gewesen ist, so kann sie nach § 35 Abs. 3 GewO zu dessen Nachteil von dem Inhalt des Urteils insoweit nicht abweichen, als es sich bezieht auf die Feststellung des Sachverhalts, die Beurteilung der Schuldfrage sowie die Beurteilung der Frage, ob er bei weiterer Ausübung des Gewerbes erhebliche rechtswidrige Taten im Sinne des § 70 StGB begehen wird und ob zur Abwehr dieser Gefahren die Untersagung des Gewerbes angebracht ist. Ein Tätigkeitsverbot ist nach § 16 Abs. 3 HandwO möglich und die Eintragung in das GZR (§ 150a GewO) ist in § 21 SchwarzarbG normiert.
[1]
Vgl. hierzu insgesamt: Müller/Schlothauer /Lehr 2. Aufl. 2014, § 21.
[2]
Dahs Rn. 99.
[3]
Böttger/ Tsambikakis/Kretschmer Kap. 14 Rn. 253.
[4]
Böttger/ Tsambikakis/Kretschmer Kap. 14 Rn. 250.
[5]
Wabnitz/Janovsky/ Möhrenschlager 29. Kap. Rn. 14.
[6]
Weihrauch/Bosbach Verteidigung im Ermittlungsverfahren, 7. Aufl. 2011, Rn. 336.
Читать дальше